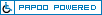Inhalt Mitte
Hauptinhalt
.Ludwig Cohn
Susanne Siems
Ludwig Cohn
1877-1962
Ein Weg zum Glück
In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts erschien das schmale Bändchen „Ein Weg zum Glück“ von Ludwig Cohn. Faszinierend an diesem Buch ist die Lebensbejahung, der Glaube an die eigene Kraft. Neben der profunden Sachkenntnis zu allen Fragen des Blindenwesens ist es dieser Optimismus, diese innere Stärke, die das Lesen so erfreulich macht.
Cohn lebte von 1877 bis 1962. Es war schwierig, etwas über seine genauen Lebensdaten herauszufinden, im wesentlichen stammen die hier gemachten Angaben aus dem vorliegenden Buch. Mit 6 Jahren erblindete er und kam zunächst in die Bienersche Blindenanstalt nach Leipzig. Nach der erfolgreichen Grundausbildung besuchte er ein integratives Gymnasium, wie wir das heute sagen würden. Seit 1904 hat er sich vor allem auch mit zahlreichen Publikationen zur Blindenfrage und in seiner Tätigkeit als Blindenfürsorger verdient gemacht. Er war Mitbegründer des Reichsdeutschen Blindenverbandes, der 1912 gegründet wurde. Es spricht nichts dafür, dass er sich in der Zeit von 1933 bis 1945 in Deutschland auffhielt. In den fünziger Jahren hielt er sich längere Zeit in Israel auf.
Als Lehrer stand er schon früh im Spannungsfeld zwischen Blindenpädagogik und Selbsthilfe. Sein Lebensweg und seine Sicht auf das Wachsen der Selbsthilfe in den ersten Jahren des 20-sten Jahrhunderts, später auch die Erfahrungen und Entwicklungen der Kriegsblindenfürsorge und -selbsthilfe in Deutschland, liest man mit großem Interesse.
Cohn war einer der ersten blinden Berufsberater. Ein nicht unbeachtlicher Teil seines Buches befasst sich mit den typischen Blindenberufen, aber auch mit den sogenannten Spezialfällen. Als einer der ersten ging er in die Betriebe und zeigte den Direktoren, dass auch ein Blinder viele von jenen Arbeiten verrichten kann, die allein für den Sehenden gemacht scheinen. Was wir heute als Training on the job bezeichnen, praktizierte er erfolgreich in den zwanziger Jahren. Dabei zeigte Cohn sehr ausgewogen Möglichkeiten und Grenzen auf. Er hob die besondere Leistung einzelner Blinder hervor, warnte im gleichen Atemzug aber auch vor der Verallgemeinerung.
Sein Herz schlug auf jeden Fall für den selbständigen, mobilen Blinden der seiner sehenden Umwelt zeigt, dass er bestimmte Leistungen erbringen kann, nicht „weil“ er blind ist, sondern „trotzdem“.
Gleichzeitig verliert Cohn aber nicht den Boden unter den Füßen, den Blick dafür, dass es neben dem Selbständigen auch den Blinden gibt, der mehr als ein anderer auf die Fürsorge der Sehenden angewiesen ist und auch auf die Fürsorge der Selbsthilfe. Ausführlich wird auf Taubblinde eingegangen, am Ende des Buches findet sich eine Darstellung des Tastalphabetes nach Hieronymus Lorm.
Auch Sehbehinderte (Schwachsichtige) finden ihren Platz, und zwar nicht als die zukünftigen Blinden, sondern in erster Linie als Menschen, deren geringes Sehvermögen geschult werden sollte.
Quelle: Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
Das Blindenghetto in Theresienstadt
von Dr. Ludwig Cohn,
Rotterdam
Anmerkung: Wie lange Cohn nach 1933 noch arbeiten durfte, ergibt sich aus seinem Büchlein nicht. Von den letzten Kriegsjahren handelt jedoch sein nachstehender Artikel:
Aus Deutschland und den besetzten Gebieten hatten sämtlich nach Theresienstadt, einer alten böhmischen Festung 60 km von Prag, alle Blinden kommen sollen. Dort war in einem Ausmaß von 7oo zu 9oo Metern, also noch kein qkm im Inneren des früher 7ooo Einwohner zählenden Tetschens ein von Stacheldraht umzäuntes Ghetto gebildet worden, in das die stark überdimensionierten in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts gebauten 10 Kasernen einbezogen waren. Entgegen der "Weisung von höheren Hand " waren große Gruppen Blinder mit allgemeinen Transporten aus ihren Wohnorten direkt nach dem Osten, in die in Polen errichteten Vernichtungszentren verschickt worden» So aus Brandenburg, Schlesien, Polen, Sachsen, Ost- und Westpreußen, aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei und Österreich, aus Griechenland und in besonders großer Zahl aus Polen selbst.
Das Lager Theresienstadt, in welches im Frühjahr 1942 die ersten Blinden kamen, worunter auch kleine Gruppen und Einzelpersonen aus den ebengenannten Gebieten sich befanden, wurde bis zum Mai 1945 von 3200 Blinden durchlaufen. Darunter befanden sich viele alte und kranke Blinde. Rund 1200 sind in Theresienstadt gestorben. 96 erlebten den Tag der Befreiung am 5. Mai 1945, so daß also rund 2000 von Theresienstadt aus den Weg des Unheils in die Gaskammern des Ostens gehen mußten. Unter ihnen auch die 4 Taubblinden, die wir im Lager hatten, neben 2 stumpfen Menschen waren da die hochbegabten Mädchen Else Dreyfuß aus Frankfurt/Main und Ilse Ransburg aus Graz/Österreich. Theresienstadt hatte eine Jüdische Selbstverwaltung, die mit allen ihren Maßnahmen dem deutschen Kommandanten verantwortlich war. Die Kommandantur lag im Ghetto. Da in dem oben umschriebenen engen Räume im Minimum 15000, durchschnittlich zugleich 25000, während einiger Wochen im Maximum mehr als 50000 Menschen zusammengedrängt waren, was bei dem häufigen Mangel von Wasser und dem last völligen Fehlen von Kanalisation zu unerträglichen gesundheitswidrigen Mißständen führte, waren sanitäre und soziale Maßnahmen das Wichtigste. Sie wurden durch ein ausgezeichnet organisiertes Wohlfahrtsamt in vorbildlicherweise durchgeführt, soweit das bei der beschränkten Zuteilung von Hilfsmitteln und Materialien möglich war.
Dr. Carel Fleischmann, ein Arzt aus Budweis in Böhmen, eine der leitenden Persönlichenkeiten im Wohlfahrtsamt (leider ist er auch nicht wieder zurückgekommen) hat sich in der Sorge für die Blinden unauslöslichen Dank erworben. Er adoptierte trotz des heftigsten Widerspruchs der Kommandantur ein Haus als Blindenheim, das mit seinen nach und nach 200 Schlafplätzen das bestehende Bedürfnis allerdings bei weitem nicht auffangen konnte; denn bei der stets fluktuierenden Belegschaft von Theresienstadt schwankte die Zahl der anwesenden Blinden zwischen 200 und 500, so daß meist der größte Teil anderweit, in der Hauptsache in den Kasernen, untergebracht werden mußte. Ich selbst hatte nur 2 Wochen in diesem Blindenheim gelegen. Im übrigen hatte ich, da man der zermürben- den Methode der Deutschen beständig die Unterkunft wechseln mußte, während 19 Monaten nicht weniger als 17 verschiedene Schlafplätze. Mit den Dingen, die Blinden betreuend, bin ich dadurch besonders betraut gewesen, weil mir Dr. Fleischmann, wenn ich so sagen darf, die Leitung des Blindenwesens übertragen und mich zu seinem diesbezüglichen Berichterstatter gemacht hat. Jeder ankommende Blinde wurde augenärztlich untersucht und es wurde eine Kartei mit sehr genauen Angaben eingeführt, deren Bearbeitung mir ebenfalls oblag.
Die Augenklinik wurde von Dozent Ernst Stein aus Brunn geleitet. Augenarzt im Blindenheim war Dr. Rudolf Lederer aus Teplitz-Schönau. Die innere Leitung des Heimes lag in den Händen von Dr. David Schapira, einem erblindeten Advokaten aus Wien, der sich durch seine geistvollen Plädoyers beim Ghettogericht einen großen Namen gemacht hatte. Die Herren Klennert und Moschkowski versahen in vorbildlicher Weise die Hausmeisterei. - Dr. Fleischmann hatte das Blindenheim in die Reihe der bevorrechtigten Institutionen einschalten können, was eine Verbesserung in Versorgung und Ernährung durch gelegentliche Extrazuteilungen zur Folge hatte, Sehende Frauen und Männer stellten sich als Begleiter, auf den beschränkten möglichen Spaziergängen und als Vorleser zur Verfügung. Kulturelle Veranstaltungen und Gottesdienste fanden auch im Heim eine Stätte.
Die Blinden in Theresienstadt waren, wie alle Insassen des Ghettos, bis zum 65. Lebensjahr zum Arbeitsdienst verpflichtet, Ihre Beschäftigung und Unterbringung in Betrieben mit Dr. Fleischmann zu besprechen, nachdem ich in den verschiedenen Fabriken geeignete Arbeitsplätze ermittelt hatte, gehörte in mein Aufgabengebiet. So arbeiteten einige in der Möbeltischlerei und Metallbearbeitung, in der Spielwaren- und Kartonnagenfabrik, in der Pantoffelmacherei und der Matratzenstopferei. Der Modelleur aus Wien verfertigte kunstreiche Drahtplastiken und der bekannte Prager Violonist, Miklos Gross, wurde in dem großen Betrieb der Glimmerbearbeitung den sehenden Arbeitern stets als Beispiel vorgehalten, weil er es besser als diese verstand, den Glimmerstein in hauchdünne Blättchen zu schneiden, ohne sich die Finger mit dem haarscharfen Messer zu verletzen. Alle diese Betriebe, die im Ghetto lagen, arbeiteten unter deutscher Aufsicht und hatten, besonders die Konfektion und Uniform-Schneiderei stets große Aufträge. Dasselbe gilt von einer Strickgruppe im Blindenheim, die immer reichlich Arbeit hatte.
Über die Einrichtung einer Bürsten- und Korbmacherei liefen noch die Verhandlungen als im Mai 1945 überall (bei uns die rote Armee) die Befreier kamen.
Daß diese Werkstätten nicht schon früher eingerichtet wurden, obgleich eine gröbere Zahl von Facharbeitern da war, lag daran, daß sich ein deutscher Bürstenmacher als Leiter ausgegeben hatte, der so roh und grob auftrat, daß die in Betracht Kommenden es vorgezogen hatten zu sagen, sie können nicht und lieber andere Arbeit übernahmen. Alles, was unter dem Schutze der Ghetto-Verwaltung außerhalb der Arbeit stattfinden konnte, mußte vorsichtig und meist gut getarnt eingerichtet werden. Dabei wurden die Deutschen mit ihrer eigenen, oft sehr eigenartigen, Terminilogie hinters Licht geführt, indem vieles unter dem Begriff "Freizeitgestaltung“ subsumiert wurde, so auch der streng verbotene Unterricht an Kindern ung Jugendlichen. Gerade der aber wurde gut organisiert, lebhaft betrieben, weil wir die Kinder nicht Schaden leiden lassen wollten.
Im Rahmen der erzieherischen Arbeit, die sehr fruchtbar war, führten wir die Kinder, besonders die ältern, in den Sozialdienst ein. Gerade davon gibt es viel Schönes zu erzählen. Als ich einmal darüber gesprochen hatte, wie blinde Kinder unterrichtet werden, auch von den Taubblinden erzählt und gesagt hatte, daß gerade diese hier im Lager sich verlassen und vereinsamt fühlten, weil außer mir sich nur einige Familienangehörige mit ihnen verständigen könnten, aber durch den Arbeitsdienst kaum Zeit hierzu hätten, bat eine große Anzahl von Kindern und jungen Menschen darum, Lormen zu lernen. Es war eine Freude zu sehen, wie sie alle wetteiferten, jede freie Minute den Taubblinden zu widmen, sie zu Spaziergängen abholten und mit ihnen sprachen. Ein Mädchen hatte eine solche Fertigkeit im Lormen, daß sie mit Vorliebe aus Büchern vorlas. Aus mitgebrachten und beim Weitertransport in Theresienstadt zurückgelassenen Blindenbüchern konnte eine kleine Bibliothek gebildet werden, die fleissig benutzt wurde. Meist in der Weise, daß sich mehrere zusammensetzten und einer von ihnen vorlas. Das gilt besonders von einer größeren
Zahl Wiener Blinden, die gemeinsam in derselben Kaserne untergebracht waren. Dort war Mathilde Lederer, eine unermüdliche Vorleserin.
Dr. Fleischmann suchte seine Blinden, die Lieblingskinder seiner Fürsorgearbeit, nach Möglichkeit zu schützen, besonders wenn ihm bekannt wurde, das sich Leute vom Bewachungspersonal immer wieder einmal in ihrer rüden Weise austobten.
Als vielseitig gebildeter und hochbegabter Mann bewährte er sich als Zeichner und Dichter. Aus seiner Feder flossen sehr schöne Verse, die sich auf Blinde bezogen. Nur vor dem Schwersten konnte er niemand bewahren, vor der letzten Deportation, der ja er selbst auch zum Opfer gefallen ist. Was sie zu bedeuten hatte, das war längst bekannt geworden. Man muß es miterlebt haben, wie da der Weg zum Tode angetreten werden mußte. Grausige Bilder haben sich unauslöschbar in meine Seele eingebrannt. Ihnen allen, die als Opfer des Nazismus dahingehen mußten, ein tiefempfundenes " Quieszant in pace ".
Dem Unheile entronnen zu sein war für jeden Einzelnen ein Glücksfall. So hatte ich durch einen Sturz von der Bodentreppe meiner Kaserne einige Rippen gebrochen, kam ins Krankenhaus und wurde vom Chefarzt bei 2 Aufrufen zum Transport für " transportunfähig" erklärt, Wunder über Wunder, diese Meldung wurde nicht nachgeprüft. So können die gebrochenen Rippen auch einmal ein Glücksfall sein.
War man, wie ich, in Bergen-Belzen aer einzige Blinde, mußte man selbst sehen wie man am besten durchkam, besonders in Bezug auf den Arbeitsdienst. Ich konnte mir damit helfen, daß ich mich beim Tragen der Suppenkessel vom Lagertor, wo sie niedergestellt wurden, bis zu den Baracken beteiligen. Keine beliebte Arbeit, denn die Kessel waren sehr schwer und die Suppe schwappte beim Lauten über und ergoß sich auf die Kleider. Daher waren dort stets Arbeitsplätze frei. Da man hierbei aber unausweichbar unter der Aufsicht des Bewachungspersonals stand, gab es manche Unannehmlichkeit. Das und andere schwere Momente mußte man in Kauf nehmen. Dafür war man als unfrei gewordener Mensch in einem KZ, indem so mancher Nazi durch übergroße Strenge und oft sehr absurter Mittel seine Sporen verdienen sollte. Man mußte verständig sein und den Kopf kühl halten. Ich pflegte mich täglich zu rasieren wenn ich Wasser zur Verfügung natte, und eine exakt gebundene Krawatte zu tragen. Beides war nicht gern gesehen. Einmal, in Bergen-Belzen, stampfte ein SS-Mann an mir vorüber, eben als ich mich rasierte. "Muß das sein, Herr Baron?" schrie er mich an. "Es muß nicht sein, ich finde es nur schön!“ antwortete ich. "Idiot!“ sagte er und ging weiter. Der Mann war gemütlich, er hätte mir ebenso gut eine herunterhauen können, wie das ja täglich wegen ähnlicher Anlässe geschah. Als einmal beim Einladen in einen Transportzug an einem Waggin in dem auch mehrere Blinde gebracht werden mußten, eine Stauung entstand, kam der
Adjudant des Kommandanten, ein besonders roher Mensch, (er und sein Ciiei endeten später am Galgen) und brüllte: "Wenn Ihr Gesindel nicht eins, zwei, drei drinnen seid, dann schieße ich Euch nieder wie Hunde, wahrhaftig, ich tue es"!
Daran brauchte man nicht zu zweifeln, so etwas kam tatsächlich vor und nicht als Ausnahme. Eine stichhaltige Rechtfertigung war dann unschwer bei der Hand.
Die äußeren Unerträglichkeiten des Lagerlebens müssen als unabwendbar in Kauf genommen werden und lassen sich bei gutem Willen ertragen und auch gelegentlich abmildern. Viel schwerer ist es, Erniedrigungen zu ertragen, die sich jeder, der in einer Uniform steckt, erlauben durfte. So wurde ich einmal auch wieder aas Opfer meines Krawattenhobys: Ein vorübergehender SS-Mann packte mich an der Krawatte: "Was soll das? Wir gehen hier nicht auf Gesellschaft. Weißt Du, was Du bist, genau so ein Stück Judensch... .dreck wie jeder andere.“
Warum sagte er so etwas ganz Unmotiviertes? Nur weil er das Machtbewußtsein als Stütze hatte. Alles aber auch alles tun und sagen zu dürfen.
Wenn man solche ähnliche und gröbere Aussprüche lediglich akustisch zur Kenntnis zu nehmen sich gewöhnt hat, konnten sie kein Angriff mehr sein auf das innere Gleichgewicht und darauf kam es ja an., sich dieses zu bewahren, wie es Horaz in einer seiner Oden empfiehlt; "Bewahre Dir auch unter den schwierigsten Umständen Deine Seelenruhe“.
Aufgrund nachträglich angestellter sadistischer Ermittelungen greift man nicht zu hoch mit den Schätzungen, daß die 1200 in Theresienstadt Verstorbenen einbezogen, etwa 5000 jüdische Blinde innerhalb von Europa durch die Nazi-Maßnahmen ums Leben gekommen sind.
Abschrift beglaubigt
M. Schöffler, 21.09.1952
Dieser Artikel wurde bereits 22983 mal angesehen.