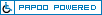Inhalt Mitte
Hauptinhalt
.Max Zodykow
Hartmut Mehls
Max Zodykow
1899-1944?
Das unvollendete Werk des Max Zodykow
„ Aus Dunkel und Enge trat ich in lichte Weite und wurde, ein zugesperrtes Ghettokind, zum aufgeschlossenen Weltkind. Ich habe beten gelernt, aber nicht buchstabieren. Ich wußte von Gott, seinen Himmeln und Höllen, aber nicht von Rechnen, Schreiben und dem Blühenden draußen“ (Zodykow 1938).
Seit Homer gab es zahlreiche blinde Sänger und Dichter. Sie alle verloren aber ihr Augenlicht in einem Alter, in dem sie die Augenwelt bereits kannten und später in ihren Dichtungen als verlorene Landschaften wieder heraufbeschworen. Eine Ausnahme im deutschen Sprachraum der jüngsten Vergangenheit bildete Max (Moses) Zodykow. Sein Name und Werk sind auch von den Blinden vergessen, obwohl er der Dichter der Licht-losen und ihrer Welt in allen Facetten war.
Sein Leben lässt sich aus Bemerkungen von Journalisten der späten zwanziger und frühen dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts und aus seinen Dichtungen skizzenhaft rekonstruieren. Dokumente fanden sich bisher erst wenige; Briefe und Zeitzeugen scheinen nicht mehr zu existieren. Die Quellen fließen also spärlich. Selbst die Fragmente seiner Autobiographie, die in Fortsetzungen 1933/34 die Kindheit zum Gegenstand hatten, sind Dichtungen, in denen es Zodykow um seine innere Entwicklung und nicht um äußere Fakten ging. Aus diesem Grunde ist lediglich eine Annäherung an Werk und Leben von Max Zodykow möglich, ohne endgültige Gewissheiten zu erlangen.
Moses Zodykow, der seine Veröffentlichungen ab 1920 mit dem Namen Max Zodykow unterzeichnete, wurde am 12. Juli 1899 nahe Kowno in Russland (Kaunas – heute Litauen) geboren. Der Geburtsort war ein ostjüdisches „Stetl“ in seiner typischen religiösen und sozialen Gestalt. Es gibt bei Zodykow mehrfach Hinweise auf seine geistige und religiöse Verwurzelung in dem Ostjudentum. Seine Familie hatte ihr sicheres Auskommen. Der Großvater war beispielsweise in der Lage, seinem Enkel wöchentlich einen Goldrubel für die Absicherung der Zukunft zu schenken.
Doch Pogrome – wenigstens einen erlebte Moses als Kind mit –, die Zwangsrekrutierungen für die zaristische Armee und antisemitische Bedrückungen durch die Behörden bewogen die meisten Familienmitglieder Anfang des 20. Jahrhunderts auszuwandern.
Die Angaben, ob Moses blind geboren wurde oder mit zwei Jahren sein Augenlicht verlor, sind nicht gesichert. Wichtig für eine Beurteilung seiner Dichtung ist jedoch die Tatsache, dass er später keine Erinnerungen mehr an optische Eindrücke besaß. Er selbst bezeichnete sich daher als „Blindgeborener“. Die Eltern akzeptierten erst spät die Endgültigkeit der Blindheit des Knaben; und bis dahin musste er die Torturen von Operationen und Behandlungen durch Quacksalber über sich ergehen lassen. Als die Eltern es akzeptierten, hatte dies katastrophale Auswirkungen für das Kind.
Denn seine Kindheit erlebte Moses in einer Welt, die wenig Verständnis für Blinde aufbrachte. Sie betrachtete ihn als Last und zeigte es ihm ständig.
Es gab aber auch Ausnahmen; an den Großvater und an ein Nachbarmädchen erinnerte er sich dankbar. Stefan Zweig schreibt im Vorwort zur einzigen Buch-publikation von Max Zodykow: „Seine Eltern flüchteten (…) aus Rußland, und weil sie arm sind, wollen sie nicht die Last eines blind geborenen Kindes in ein fremdes Land mitnehmen. So bleibt in einem jämmerlichen kleinen Dorfe bei der Großmutter ein kleiner blinder Junge zurück. Vollkommen vernachlässigt und verwahrlost von seiner Umgebung und abgeschlossen wie mit stählernen Mauern von der wirklichen Welt“ (Zodykow o. J., 4).
Die durch die Handlung der Eltern verwundete kindliche Seele heilte nie. Der Großvater, der zu dieser Zeit bereits verstorben war, fehlte dem Kind als Bezugsperson.
Er war als etwa Fünfjähriger nur auf sich selbst zurückgeworfen.
Über die Kindheit erfahren wir vor allem aus dem autobiographischen Romanfragment „Kindheit im Dun kel, die Geschichte eines Fremden“, das in Fortsetzungen in dem „Israelitischen Familienblatt“ 1933/34 erschien. Mit dem Titel weist Zodykow nicht nur auf seine Blindheit hin, sondern auch auf die dunkle und hoffnungslose Kindheit und gleichzeitig auf das Unverständnis, auf das seine Blindheit stieß. Diese dunkle Kindheit war dem 34jährigen Mann selbst fremd und unverständlich. Er versuchte in dem Roman sie als Außenstehender zu betrachten, um eine innere Distanz zu bekommen. Neben der literarischen Qualität des Fragments handelt es sich bei dem Text auch um ein einmaliges pädagogisches Zeugnis. Es ist die Kindheit eines blinden Kaspar Hauser. Als die Großmutter starb, verfrachtete man den zwölfjährigen Knaben in einen Zug, der ihn zu seinen Eltern nach Berlin brachte. Deren Überraschung war groß, die Freude hingegen keineswegs. Die Ankunft in einem fremden Land, dessen Sprache er nicht verstand, der Empfang durch die Eltern und deren Versuch, ihn vor der Umwelt zu verbergen, wurden zu einem Schlüssel-erlebnis des Knaben, das in seiner späteren Dichtung immer wieder aufscheint. Das literarische Motiv, als Blinder hilflos der Umwelt ausgeliefert zu sein, hatte in den kindlichen Erfahrungen seine Wurzeln.
Aber die Eltern blieben nicht in Berlin. Sie zogen weiter nach Amerika und ließen das blinde Kind abermals zurück. Es hatte allerdings das große Glück, nach schwierigen Verhandlungen im Jahre 1912 in die Jüdische Blindenanstalt in Steglitz bei Berlin, Wrangelstraße 6/7, die 1910 gegründet worden war, aufgenommen zu werden.
Über seine Vorbildung berichtet Stefan Zweig: „Einem Dienstmädchen dankt er, daß er im dreizehnten Jahre einige wenige Buchstaben abtasten kann, die er – welcher Dichter würde einen solchen Zug so genial erfinden? – von den vorspringenden Glasbuchstaben auf Sodawasserflaschen gelernt hat“ (5).
Obwohl die Schülerakte in der Johann-August-Zeune-Schule für Blinde und Sehbehinderte noch nicht gefunden wurde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß Moses Zodykow zu den fünf jüdischen Schülern gehörte, die als Externe 1912/13 die Königliche Blindenanstalt in Steglitz besuchten.
Max Zodykow schreibt rückblickend: „Mit dreizehn Jahren in eine Blindenanstalt gekommen, habe ich nie eine Schule gekannt. Mit Heißhunger und Fleiß schlürfte ich in einem Jahr ein Pensum von acht Jahren in mich ein. Mein Erlerntes war nurmehr kaum erhascht und erjagt, als ich mit vierzehn Jahren in die Bürstenbinderei kam. Das ist nichts Besonderes, nichts Unglaubliches, Schreckliches und Sensationelles. Das haben Tausende vor mir und mit mir erduldet und erlitten. Da ist nichts zu bemitleiden, das gerächt und gerichtet werden könnte“ (51).
Sein Lesedrang ist unersättlich, und bald beherrscht er die deutsche Sprache und verfügt über solide literarisch-philosophische Kenntnisse.
Während er zunächst als Bürstenmacher glücklich war, weil er überhaupt eine nützliche Tätigkeit erhielt, haderte er später mit dem Schicksal, weil er von einer wissenschaftlichen Bildung ausgeschlossen war. Er war am Tage gezwungen, Bürsten anzufertigen – er war ein geschickter und fleißiger Bürstenmacher – und formte dabei in Gedanken Gedichte, Geschichten, Romane, Dramen und Essays, die er dann in seiner freien Zeit niederschrieb. Zodykow trug stets eine Punktschrifttafel und Papier bei sich. Die Stunden der dichterischen Produktion bildeten für ihn das eigentliche, das schöpferische Leben. So vergehen die Jahre, von denen wir nur durch seine Dichtungen und über kurze Zeitungsmeldungen etwas erfahren.
Er vertiefte sich in das Leben, Denken und die Empfindungswelt der Lichtlosen. Max Zodykow war ihr Dichter. Hinter diesem Anspruch, den er an sich selbst stellte, trat seine Biographie zurück, und sie bot ihm lediglich das Rohmaterial für seine dichterische Aussage. Denn selbst von seiner Heirat mit Bella Bergmann, die am 6. Januar 1902 in Frankfurt am Main geboren worden war, und über ihr gemeinsames Leben erfahren wir nur im Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen Deportation ins Todeslager Auschwitz im Dezember 1943.
Ab Mitte der zwanziger Jahre erscheinen in der Tagespresse einzelne Gedichte und Prosastücke sowie Besprechungen von Veranstaltungen, auf denen Zodykow selbst oder Künstler aus seinen Werken rezitierten. Auch ein Schauspiel wurde aufgeführt. Aber nur ein Bericht beschreibt den Erfolg des Abends, das Stück selbst ging wahrscheinlich verloren – wie der größte Teil seines umfangreichen Schaffens.
Das bereits erwähnte schmale Bändchen mit seinen Gedichten und Prosatexten war die einzige Publikation in Buchform, die Zodykow veröffentlichen konnte. Sie behandelt ausschließlich Themen, in denen er in direkter Form oder in poetischen Bildern die Blindheit zum Gegenstand seiner Dichtungen gemacht hatte.
Das literarische „Ich“ beleuchtete schlaglichtartig die ganze Vielschichtigkeit des Nichtsehens beim Individuum und dessen Verhältnis zur sehenden Umwelt, wobei der Autor stets durch die „private“ Geschichte gesellschaftliche Beziehungen verdeutlicht, ohne jedoch vordergründig oder belehrend zu werden. Er bleibt auch hier Dichter, der das Allgemeine im Besonderen widerspiegelt. Der Dichter verurteilt nie, sondern erzählt vor allem in seiner Prosa eine konkrete Geschichte, die durch ihre Gestaltung zum Gleichnis wird.
Max Zodykow betont prononciert den Standpunkt des Geburtsblinden, wobei ihm durchaus bewusst war, dass in dieser Themenwahl die Einmaligkeit seines Werkes liegt. Aus der Vielzahl der Beispiele werden nur einige Strophen aus einem Gedicht ausgewählt, in denen Max Zodykow ein beliebtes Thema seiner Zeit aufgriff:
Der Garten der Welkenden
Dunkel-hohe Wipfel rauschen,Wie vom Atem naher Wälder angetrieben.Ausgespannte Winde lauschenUnd darunter wandeln Fremde, die nicht lieben. –
Dreizehn Männer, siebzehn Frauen, Schreiten um ein Beet, das blüht.Paarweis eingehakt, in Reihen,Auf den Lippen stummes Schreien,Schreiten, schreiten sie im Grauen,Ohne Lächeln, ohne Schauen,Um das Beet, das lachend blüht.(…)Leben, Leben, hallt ihr Takt,Leben … ausgeglüht, fremd, abgehackt, Leben, ohne Sinn und Ziel, Leben nur, gleichviel –Eingesenkt in dunkelschweres Lauschen,Können sie an Weltfahrt sich berauschenWollen kühn mit Wind und Vogel tauschenUnd noch tanzen, tanzen über Schmerz und Spott.Denn ihr Gott ist tot, und Tod heißt jetzt ihr Gott.In den Wind geht hin ihr Flehen.Und aus allen Fenstern starren Augen,Augen, die geringstes Zucken sehen, Die nichts schonen, nichts verstehen,Die aus Furchtsamen die letzten Kräfte saugen,Daß sie schlingern, gleiten und sich schämen fortzugehen.Wangen werden fahl, Haare bleichen weiß.Alltag, Festtag, stets der gleiche Kreis.Keiner mag den Ring verlassen,Denn der Garten hält sie gut.Irgendwo sind laute Gassen,Irgendwo schreit Not, tobt Streit und Glut,Draußen braucht man immer Mut,Glück und Willen;Hier ist FriedeUnd der Garten hält sie gut. – (17 ff.).
Das Verhalten der dreißig – reale Zahl der Insassen des Jüdischen Blindenheimes! – aber leitet Zodykow aus ihrem Schicksal und ihrer Psyche ab, wobei der Unterschied deutlich wird zu den Gedichten von Margarethe Wilhelm, die ihren Aufenthalt im Heim als Zeit der unbeschwerten Kindheit und Freundschaft darstellt, und Oskar Baum, Adolf von Hatzfeld und Alexander Reuß, die ein hartes Urteil über das Leben in Blindenanstalten fällen.
Die Letztgenannten wiesen mehr oder weniger deutlich den Direktoren der Blindenanstalten die Schuld an Unzufriedenheit und Missbehagen unter den Insassen zu. Hier ist nicht der Ort, um das Verhältnis zwischen Direktoren und Heimbewohnern – und damit die Aussagen jener Autoren – zu analysieren, sondern es geht um den schicksalhaften Ausgangspunkt, den Zodykow in seinen Versen wählt. Er geht im Gegensatz zu den genannten Autoren von den Bedingungen der Blindheit aus und leitet daraus das Verhalten der Lichtlosen ab, wobei er die Seite der Sehenden nicht weniger deutlich beleuchtet. Seine Kindheitserfahrungen erzeugten den anderen Blick auf das Heim. Es war nicht das Heim, welches Leben und Verhalten der Blinden bestimmte, sondern die Blindheit und die daraus erwachsenen Bedingungen. Das Leben der Lichtlosen kann im Heim nie zur Idylle werden, denn es ist Rückzug aus dem Existenzkampf, der nur mit individuellen Einschränkungen erkauft werden kann.
In dem Prosatext „Der kleine Übermensch“ dringt Zodykow in die Psyche des Blinden vor und zeigt die Quellen seiner Kraft. Der „kleine Übermensch“ fragt den Blinden, den er begleitet: „’Haben Sie sich niemals nach dem Tode gesehnt?’ ‚Oft schon. Aber immer quoll aus diesem Gedanken ein Strom neuen Lebens. Mein Leben ist in der Gemeinschaft. Ich versuche so viel als möglich aus mir für sie zu schaffen’“ (68).
Stefan Zweig weist im Vorwort des Bändchens auf vermeintliche formale Schwächen in der Dichtung Max Zodykows hin. „Um dieser großartigen Anstrengung allein schon, mit der hier ein Blindgeborener uns, denen das Antlitz der Welt offen liegt, seine eigne unzulängliche Welt aufschließt, haben Max Zodykows Gedichte ein Anrecht, aufmerksam und respektvoll beachtet zu werden. Formal sind sie selten vollendet, denn wie könnte sich Formsinn völlig entfalten bei einem, der nie einen Kristall geschaut, der nie die ebenmäßig reine Ebene eines Horizonts bewundern durfte oder das farbige harmonische Gebilde einer Blüte“ (5).
Hier soll nicht untersucht werden, ob manche Reime gewählt wurden, weil die Ausdrucksfähigkeit des Dichters nicht ausreichte oder ob er sprachliche Unebenheiten als Widerhaken für den Leser einbaute. Zu einem Fehlschluss des eben zitierten Passus’ nimmt Max Zodykow in seinem Rundfunkvortrag am 22. Oktober 1929 Stellung. Er spricht über das Thema „Der blindgeborene Dichter“: Der Blinde kennt die Welt „nur vom Tasten, Ahnen und Hörensagen. Worüber soll er schreiben? – Die Frage ist (…) nicht ganz unrichtig. Ich frage aber: Ist das nicht auch eine Welt? Und sollte sich der Versuch nicht einmal lohnen, gefühltes Schauen, erhorchtes Wissen und alle die tieferen Beziehungen von Dunkel und Licht, Gefangenschaft und Freiheit, Enge und Weite sachlich zu erkennen und es in Worten auszusagen? (…) Weit strecken sich die Hände nach jedem Klang und Gegenstand, die Lunge atmet Häuser, Kleider, Sonne und Tiere, das Ohr ist hell, geschärft, die Seele wach und sehend“ (Zodykow 1929, Punktschrift-Seite 497 ff.).
Zodykow zeigt dann auf, wie der Blinde diese Welt erlebt, sie sich aneignet und sie schließlich wieder so zusammensetzt, dass die Welt der Blinden von den Sehenden erkannt und verstanden wird. Diese Rekon-struktion durch Blinde für Sehende ist der schwerste Teil der dichterischen Arbeit des Blinden. Der blinde Dichter skizziert die Welt, wie und mit welchen Mitteln der Nichtsehende sie erfasst und lehrt den Augenmenschen, die Welt mit den anderen Sinnen neu zu „sehen“. Die Dichtung des Blindgeborenen vermag so den Rahmen der Blindenwelt zu sprengen. Seine Dichtung wird damit zum Lehrstück für die Sehenden zum bewussten Erfassen der Welt.
Die schwere Kindheit und Jugend, die Blindheit und die damit verbundene Themenwahl sowie sein Bekenntnis zum Judentum hemmten einen schnellen literarischen Erfolg und erzwangen sein Verstummen nach der Übergabe der Macht an den staatlich forcierten Antisemitismus. Bis September 1938 erschienen noch einzelne tiefreligiöse Gedichte und die schon erwähnten Bruchstücke seiner Autobiographie. Zodykow hing immer dem Glauben seiner Väter an, aber unter dem Druck des Rassismus bekannte er in der letzten bisher aufgefundenen Dichtung: „Ich bin als Jude geboren und trage mein Erbe wie ein Fürst seinen Adel“ (Zodykow 1938).
Über das letzte Jahrzehnt seines Lebens wissen wir nichts mit Gewissheit. Wahrscheinlich arbeitete Max Zodykow mit den anderen blinden jüdischen Bürsten-machern in der Werkstatt von Otto Weidt.
In der „Vermögenserklärung“, die jeder Jude vor der Deportation nach Auschwitz ausfüllen musste, versuchte das Ehepaar Zodykow möglichst wenig von sich und seinen Helfern preiszugeben, um keine andere Person zu gefährden. Denn vom März bis Dezember 1943 lebte das Ehepaar Zodykow illegal in einer Wohnküche im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg bei Bertha Cohn. Das Ehepaar Zodykow wurde am 7. Dezember 1943 nach Auschwitz deportiert, und danach fehlt jede Nachricht.
Literatur
Zodykow, M.: Stimme aus dem Dunkel. Berlin o. J. (wahrscheinlich 1929), 4, 5, 51, 17 ff., 68, 5,
Zodykow, M.: Selbstbiographie in Aphorismen 1938
Zodykow, M.: Der blindgeborene Dichter. In: Marburger Beiträge 1929, H. 11, PS 297 – 497, 506
Vermögenserklärung von Moses Zodykow. Brandenburgisches Landeshauptarchiv
(BLHA), Rep. 36a, Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg (II), Nr. 041403
Quelle: 200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806-2006),
edition Bentheim, 2006, Würzburg
Dieser Artikel wurde bereits 24705 mal angesehen.