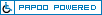Inhalt Mitte
Hauptinhalt
.Gemeinsame Aufgaben und Möglichkeiten säkularer und christlicher Sehgeschädigtenorganisationen in einer sich wandelnden Welt - 5.
5.
Prof. em. Dr. Theodor Strohm
Aufgaben und Möglichkeiten diakonischer Arbeit in einer sich wandelnden Welt
Vorbemerkungen
Die so liebenswürdige Anfrage von Herrn Dr. Schulze konnte ich nur mit einer Zusage beantworten. Wenn man von einem so jungen 80 Jährigen gefragt wird, kann man sich nicht damit entschuldigen, dass ich schon 70 Jahre alt bin und nicht mehr über institutionelle Ressourcen verfüge. Ich danke Ihnen sehr, dass ich auch als Lernender in Ihrem Kreis mitwirken darf. Ich habe selbst noch zu wenig Erfahrung auf diesem Gebiet. Zwei Jahre durfte ich meine 96-jährige Mutter, die plötzlich eine 90%ige Sehbehinderung erlebte, begleiten. Sie konnte über 50 Lieder auswendig und hatte ein Keyboard in ihrem Zimmer. Sie sang täglich ihre Lieder. Meine Tochter ist beteiligt an dem Züricher Gasthaus-Projekt "Blinde Kuh", in dem Blinde in völliger Dunkelheit mit großem Erfolg ihre Gäste bewirten.
Ich selbst arbeite gerade über die "Entstehung einer sozialen Ordnung Europas in der frühen Neuzeit". Da fand ich bei dem Humanisten Juan Luis Vives in seinem sozialpolitischen Standardwerk "De subventione pauperum" (1526) die Bemerkung: Keinesfalls sollte man die Blinden müßig sitzen lassen: "Es gibt doch vieles, was sie treiben können. Manche eignen sich für wissenschaftliche Beschäftigung - die mögen sie treiben... Andere haben Lust auf Musik - die mögen singen, Leier und Flöte spielen. Manche können Räder und Mühlen drehen, andere die Kelter bedienen oder in der Schmiede arbeiten. Bekanntlich können Blinde gut Schachteln, Kästen, Körbchen und Bälle verfertigen. Blinde Frauen mögen spinnen und Garn wickeln... Alten und Siechen muss man natürlich leichte Beschäftigung geben... Aber so schwach ist niemand, dass er überhaupt nichts tun könnte..."
Zu meiner Person darf ich soviel sagen: Ich bin viel herumgekommen, ich war Studienleiter im Evangelischen Studienwerk in Villigst, Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Christliche Gesellschaftswissenschaften in Münster, Prof. für Sozialethik in Berlin und Zürich und für Praktische Theologie und Diakoniewissenschaft in Heidelberg. Fast 20 Jahre war ich Vorsitzender der Kammer der EKD für Soziale Ordnung und hatte dort Gelegenheit, die sozialpolitische Entwicklung und Gesetzgebung in Deutschland in den 80-er und 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts aktiv mitzugestalten.
Wir haben in der Sozialkammer vor kurzem wieder zwei Denkschriften veröffentlicht:
1. "Solidarität und Wettbewerb - Für mehr Verantwortung, Selbstbestimmung und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen - Eine Stellungnahme des Rates der EKD", Hannover 2002, in der wir wichtige Leitlinien für die jetzt anstehende große Gesundheitsreform aus evangelischer Sicht vorgezeichnet haben.
2. "Soziale Dienste als Chance - Dienste am Menschen aufbauen, Menschen aktivieren, Menschen Arbeit geben. Eine Studie der Kammer der EKD für soziale Ordnung", Hannover 2002/2003. Dort wurde die kirchliche Sozialarbeit auf den Prüfstand gestellt und aufgezeigt, an welchen Punkten wir auch zu ganz neuen Überlegungen finden müssen.
Ich wurde von Herrn Dr. Schulze eingehend informiert über die Entwicklung der verbandsmäßigen Arbeit der Blinden- und Sehbehinderten und ihre Dienste. Wir können mit Dankbarkeit auf all´ die Leistungen zurückblicken, die von den Sehgeschädigtenorganisationen zum Wohl und zur Integration dieses Personenkreises hervorgebracht wurden. Auch die Vielzahl der säkularen und kirchlichen Einzelverbände und Ihre Bemühung um Koordination und Zusammenarbeit verdient Bewunderung. Sie fragen mit Recht, wie es weitergeht in einer vom raschen sozialen Wandel gezeichneten Welt.
Lassen Sie mich in zehn Thesen meine Gesichtspunkte zu Ihrer Frage vortragen und erläutern. Ich freue mich auf die anschließende Diskussion.
1. These: Die Ansicht ist heute weit verbreitet, dass sich das Christentum mit seiner spezifischen Weltorientierung, seinen Lebensformen und Werten auf dem Rückzug befindet. Es habe sich gegenüber der darwinistischen Ideologie des Nationalsozialismus - und gegenüber der Ideologie des dialektischen Materialismus ebenso wenig behaupten können, wie gegenüber der Eigendynamik technischer und naturwissenschaftlicher Revolutionen, die heute im Zeichen der Globalisierung das Gesicht der ganzen Erde prägen.
Schon der großartige Physiker Max Born befürchtete am Ende seines wissenschaftlichen Weges die "Zerstörung der Ethik durch die Naturwissenschaften". Er sprach vom Zusammenbruch aller ethischen Grundsätze, die sich im Laufe der Geschichte entwickelt und ein lebenswertes Leben gesichert haben. Dies gilt sowohl für Zeiten des Friedens wie des Krieges: "Im Frieden war harte Arbeit das Fundament der Gesellschaft. Ein Mensch war stolz auf das, was er gelernt hatte, und auf die Dinge, welche er mit seinen Händen schuf. Geschicklichkeit und Sorgfalt standen hoch im Kurs". Heute hätten Maschinen die menschliche Arbeit entwertet und ihre Würde zerstört. Heute sei ihr Zweck, ihr Lohn das bare Geld. Selbst im kriegerischen Konflikt waren die anerkannten Kennzeichen des Soldaten Stärke und Mut, Großmütigkeit gegenüber dem unterlegenen Feind und Mitleid gegenüber dem Wehrlosen. Moderne Waffen der Massenvernichtung lassen keinen Raum für irgendwelche sittlich begründeten Einschränkungen und degradieren den Soldaten zu einem technischen Mörder.
Einer unserer führenden Vertreter der Diakonie, Prof. Reinhard Turre, Direktor des Diakonischen Werkes in der Kirchenprovinz Sachsen, hat kürzlich folgende These vertreten:
"In der Folge der Aufklärung hat sich besonders in Deutschland eine immer stärkere Individualisierung vollzogen. Die beiden totalitären Gegenentwürfe - der Nationalsozialismus und der real existierende Sozialismus sind gescheitert. Aber auch die ursprünglich stützende Gemeinschaft in Familie und Nachbarschaft ist weithin zerbrochen. Längst sind schon nicht mehr Kleinstfamilien, sondern Singles die meist anzutreffende Lebensform. Der real existierende Individualismus mit seinem Anspruch auf Autonomie jedes Einzelnen gefährdet die Grundlagen des Gemeinwesens. Dieses ist auf Gemeinsinn und soziales Verhalten angewiesen. Institutionen können nicht ersetzen, was Personen einander gewähren müssten. Eine soziale Ordnung ist darauf angewiesen, dass die Bürger ein gewisses Maß an Zeit, Aktivität, Energie und Geld für den Dienst an gemeinsamen Zielen aufbringen. Tatsächlich hat aber die Selbstsucht und die Habsucht der Einzelnen zugenommen. Die meisten Menschen versuchen, aus dem Gemeinwesen und den Solidarsystemen für sich herauszuholen, was nur geht und längst schon nicht mehr geht. Es ist diese Grundhaltung des Individualismus, der sich in Egoismus gewandelt hat, die unsere Gesellschaft gefährdet".
Hier meldet sich sicher auch das Erschrecken eines nachdenklichen Bürgers, der die Wende aus der DDR-Vergangenheit in das vereinigte Deutschland aktiv miterlebt hat. Wir werden zu prüfen haben, ob wir diesem Pessimismus nicht auch Hoffnungsperspektiven gegenüberstellen können.
Unübersehbar befinden sich auch die Kirchen in einer Krise. Kürzlich äußerte Limburgs Bischof Franz Kamphaus, die Kirche sei "offenkundig in einer tiefgreifenden Krise." "Unwiederbringlich vorbei" seien die Voraussetzungen für die bisherige Gestalt der Kirche. Es sei keine "hausgemachte" Krise der katholischen Kirche, sondern eine fundamentale Gotteskrise. Eine "diffuse Gottgläubigkeit" werde von der Gesellschaft toleriert, aber kein Glaube "mit Konsequenzen, mit klaren Forderungen, die die eigenen Lebenskreise stören". Er rief die Katholiken zu "Echtheit und Glaubwürdigkeit" auf. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die European Values Study (EVS). Der Pater Prof. Jan Kerkhof S.J. (Leuven) fasste ihre Ergebnisse folgendermaßen zusammen:
"In dem traditionellen Spannungsfeld zwischen der Immanenz und der Transzendenz Gottes scheint der Europäer mehr und mehr zum Verfechter der Immanenz, ja sogar eines Agnostizismus religiöser Färbung zu werden. Bloß eine kleine Minderheit erwartet von den Kirchen Europas eine Lösung ihrer Probleme. Die Mehrheit jedoch erwartet noch immer Hilfe beim Suchen nach einer Antwort auf die Sinn-Fragen, wie auch auf die Herausforderungen, welche etwa die Armut, der Rassismus und die Ungerechtigkeit für sie bedeutet. Anders gesagt: einen aktualisierten und glaubwürdigen Prophetismus, als Diakonie der Glaubensgemeinschaft für eine verwirrte und heimlich doch Hoffnung suchende Welt."
An dieser Erwartung und Hoffnung der Menschen wird rasch deutlich, wo heute der kirchliche Dienst und der diakonische Auftrag anzusetzen ist.
2. These: Diese Frage will ich in einer zweiten These exemplarisch behandeln. Es erhebt sich die Frage, wie junge Menschen heute zu einem eigenen Werteverhalten und Werteurteil befähigt werden. Vor allem die mit der zunehmenden Individualisierung einhergehenden Lebensbedingungen führen dazu, die Frage nach der Vermittlung "sozialer Verantwortung" als Bildungsaufgabe neu zu stellen. Folgte man den Äußerungen der pessimistischen Jugend- und Gesellschaftskritik, so wäre das Thema "Soziales Lernen" ebenso zentral notwendig wie chancenlos. Wenn, wie oft behauptet, keine Gemeinde, kein Milieu, keine Familie, kein Beruf, keine Beziehung, keine Geschlechtsrolle, kein Glaube oder keine Weltanschauung mehr eine Heimat bieten oder der Lebensgeschichte Kontinuität verleihen, dann entsteht, so wird diagnostiziert, eine Seelenlage, die das "Ich" als eine Art Großbaustelle, in der ständig neue Gebäude angefangen, selten aber vollendet werden, erscheinen lassen. Ulrich Beck sagt: "Es ist oder wird ganz unklar, ob Individuen ein oder mehrere Leben, ein oder mehrere Identitäten haben oder leben sollen oder wollen." Er schreibt dies in dem Buch "Das eigene Leben. Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben" (1995).
Individualisierung beschreibt Beck in drei Dimensionen: als Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindungen im Sinne traditioneller Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge (Freisetzungsdimension); als Verlust an traditionalen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen (Entzauberungsdimension); als Entwicklung neuer Formen eigenverantworteter sozialer Einbindung in Wahlverwandtschaftsfamilien, sozialen Netzen etc. (Kontroll- und Integrationsdimension).
Die Konsequenz solcher Ausgangsbedingungen ist, dass wachsende Defizite in den integrativen Lebensformen und sozialen Erfahrungsbereichen nur durch gesellschaftlich geförderte Netzwerkstrukturen, bürgerschaftliches Engagement und Einübung in Verantwortung überwunden werden können. Die 13. sog. Shell-Jugendstudie im Jahr 2000 hat die Einstellungsmuster Jugendlicher zu wichtigen Lebensfragen anschaulich herausgearbeitet. Wenn man davon ausgeht, dass sich Heranwachsenden die Auseinandersetzung mit Fragen des Sozialen heute nicht mehr ungeplant und nebenbei vermittelt, wird eine systematische Form des inszenierten Lernens des Sozialen notwendig durch eine Bereitstellung von Orten, Formen und Inhalten dieses Lernens. Es wird also konsequent danach zu fragen sein, wie junge Menschen an dieses Thema des Erwerbs notwendiger sozialer Kompetenz herangeführt werden. Mit der Vermittlung sozialer Kompetenz ist gemeint das Verstehbarmachen und Erfahrbarwerden der elementaren Bedeutung der Solidarität für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Der Weg dahin muss soziale Begegnungen ermöglichen, soziale Ersterfahrungen im Umgang mit anderen Menschen praktisch wie reflexiv eröffnen, soziale Anregungsmöglichkeiten bieten. Das heißt: die umfassende Auseinandersetzung mit Fragen des Sozialen und der gesellschaftlichen Solidarität muss sozusagen "von Amts wegen" systematisch gefördert und sekundär ermöglicht werden.
Das Diakoniewissenschaftliche Institut hat gemeinsam mit der katholischen Kirche ein landesweites Projekt diakonisch-sozialen Lernens angeregt und in verschiedenen Schulen, u.a. in der Elisabeth-von-Thadden-Schule (Heidelberg) erprobt. Die Landesregierung hat den Auftrag erteilt, in allen Teilen des Landes Lehrerfortbildungen mit dieser Thematik zu veranstalten und sämtliche Schulrektoren über diese Innovation zu informieren. Es wird also deutlich, dass die Kirchen nicht nur in ihren Stellungnahmen, sondern ganz konkret im Angebot ihrer Lebensformen die für das menschliche Leben unentbehrlichen christlichen Werte in aktueller Form vermitteln sollen.
3. These: Eine Schülerin der Thadden-Schule absolvierte ein zweiwöchiges Praktikum in der Blindenschule in Ilvesheim. Ihr Bericht macht deutlich, dass junge Menschen bei entsprechender Anleitung hochwertige Erfahrungen sammeln und in ihr Lebenskonzept einbringen können. Ich zitiere deshalb etwas ausführlicher aus ihrem Bericht über das "Sozialpraktikum an der Blindenschule Ilvesheim".
Über die Schule:
Die staatliche Schlossschule Ilvesheim ist seit 178 Jahren eine Einrichtung für sehbehinderte und vollblinde Schüler. Nach Wien und Berlin ist es die älteste Schule ihrer Art im gesamten deutschsprachigen Raum. Es gibt 130 Schüler, die die Blindenschule besuchen. Wie in jeder anderen Schule auch, beginnt der Unterricht mit der ersten Klasse. Natürlich geht das Lernen viel langsamer voran.
Blinde Schüler lernen die Welt durch Ertasten kennen. Jedes Kind ist auf eine andere Art und Weise sehbehindert, z.B. geburtsblind, farbenblind und alle möglichen Arten des "Nicht-Sehens".
So muss mit jedem Schüler individuell gearbeitet werden. Gemalt wird mit den Fingern, im Biologieunterricht werden Pflanzen und Tiere ertastet, für den Geometrieunterricht gibt es Würfel mit aufgesetzten Linien und Punkten. Hauptfach ist natürlich das Erlernen der Blindenschrift. Diese wurde vor 150 Jahren von dem blinden Franzosen Louis Braille aus einer Art Hilfsschrift entwickelt. Sie besteht aus 6 Punkten in einem Rechteck. Jeder Buchstabe des Alphabets ist besonders angeordnet, sodass der Blinde durch die Punkte die Buchstaben erkennen kann. Durch die Computertechnik ist vieles leichter geworden. In Ilvesheim sehen die Klassenzimmer aus wie Büros bei SAP. Nach Grad ihrer Behinderung und ihrer Sehfähigkeit gehen die Schüler von der Grundschule weiter auf Sonder-, Förder-, Haupt- oder Realschule. Die Abschlussprüfungen der Realschule sind identisch mit den normalen Realschulprüfungen.
In der Blindenschule gibt es auch seit 1826 ein Internat, in dem Schüler von Montag bis Freitag wohnen. Auch externe Schüler werden hin und wieder, nach Absprache mit den Erziehern, Zivildienstleistenden und Praktikanten des Internats, aufgenommen.
Ich arbeitete in einer Internatsgruppe mit 8 Jungen, die im Alter von 10-16 Jahren sind. Meine Jungs heißen David, Atilla, Daniel, Manuel, Sebastian, Karsten, Denis und Jonas."
Den ersten Tag in der Schule beschreibt sie so:
"1.Tag Mo. 17.02.2003 Meine Arbeitszeit begann um 12.00 Uhr.
Mit zitternden Beinen ging ich in das Internat. Alle Schüler meiner Gruppe waren noch im Unterricht, aber die Erzieher Petra und Ferdinand begrüßten mich sehr herzlich. Jeden morgen haben die Erzieher eine Besprechung, in der der Tagesablauf besprochen wird.
Um 12.45 Uhr gingen wir in den Speisesaal, und dort begegnete ich zum ersten Mal meinen Jungs.
Ich war aufgeregt und hatte Angst. Wie verhalte ich mich, wie viel darf ich helfen? Als erstes musste ich den Tisch decken und das Essen für meine Gruppe aus der Küche holen. Schon nach kurzer Zeit waren meine Ängste vorbei; denn die Stimmung war fröhlich und locker. Nachdem die Schüler mich ertastet hatten, war ich akzeptiert.
Ich musste das Essen auf die Teller füllen, heute gab es Tortellini. Als ich den kleinen Manuel fragte, ob er Tortellini mag, sagte er: "Na klar, ich bin doch ein halber Italiener!" Nachdem ich den Tisch abgeräumt hatte, ging ich zurück in meine Gruppe.
Dort befanden sich nur wenige Schüler, die anderen hatten Nachmittagsunterricht. Jonas fragte, ob ich Lust hätte, UNO zu spielen. Wie können Blinde ein Spiel spielen, in dem es um Farben geht, schoss es durch meinen Kopf. Ich bemerkte, dass die Karten Blindenschrift haben und manche Schüler noch Farben verschwommen erkennen können. Die Spiele ziehen sich dadurch natürlich in die Länge, aber mit der Begeisterung, mit der gespielt wurde, wurden auch drei Stunden UNO nicht langweilig. Dann habe ich gegen David Tischfußball gespielt. Als Ball wird ein neongelber Golfball benutzt. Dies ist einfacher für die Schüler, da dieser Ball lauter ist und sie neongelb besser sehen können. Tischfußball wird fast nur mit dem Gehör gespielt. Trotzdem gewann David fast immer gegen mich."
Nach einem Tagebuch über die weiteren Tage fasst die Schülerin ihre "Erfahrungen/Gefühle/Gedanken" wie folgt zusammen:
"Das Diakonie-Projekt an der Blindenschule Ilvesheim war für mich eine große Lebenserfahrung, Ich habe in den zwei Wochen nicht nur neue und interessante Menschen kennen gelernt, sondern auch sehr viel über den Umgang mit seh- und geistigbehinderten Kindern gelernt. Meine Ängste am Anfang waren:
"Wie ist es, in blinde Augen zu sehen? Dieser leere Blick, stößt er mich ab? Werden die Kinder mich als Störenfried in "ihrer Welt" betrachten? Wie viel Nähe darf ich zulassen, darf ich die Kinder anfassen? Wie viel Hilfe darf ich anbieten, ohne dass sie sich wie Idioten vorkommen?"
Meine Gruppe war aber so nett, dass sich die Ängste schon am ersten Tag auflösten! Natürlich hatte ich von Anfang an meine "Lieblinge", aber ich glaube, das ist normal: Jeder Mensch entwickelt seine Sympathien. Allerdings muss man aufpassen, diese Gefühle immer im Gleichgewicht zu halten.
Die Blindenschule Ilvesheim ist eine Welt für sich. Schon wenn man hinein will, muss man auf einen Summer drücken, dann erst öffnet sich das Tor, Hinter dem Eingangstor steht ein Lageplan, der wie ein Relief gestaltet ist. Hier können die Blinden mit den Händen die einzelnen Gebäude und Wege ertasten. Die Sportplätze sind abgegrenzt, damit die Kinder nicht ins Leere laufen. Der Fußball klingelt, die Golfbälle leuchten in Neonfarben. Aber es gibt auch Tandems, Fahrräder; denn auch Blinde können hinter einem sehenden Piloten fahren.
Meine Gefühle sind irgendwie 'wissender' geworden, allein wenn ich an einer Ampel stehe und das Summen für die Blinden ertönt. Jetzt wird mir erst klar, wie wichtig das ist. Oder: wenn Hindernisse auf dem Bürgersteig stehen, muss ich sofort an meine "Jungs" denken und würde sie am liebsten anrufen und erklären, welche neuen Hindernisse ich gerade entdeckt habe. Mir wurde klar, welch großartige Erfindung der Computer für Blinde ist. Mit dem Computer kommt die Welt ins Haus. Sie können nun Bücher `lesen´, E-Mails verschicken, telefonieren. Die Zeit ist vorbei, in der geistig gesunde Blinde Stühle und Körbe flechten müssen. In Marburg gibt es sogar eine Blindenuniversität. Schüler aus Ilvesheim werden Radiomoderatoren, Journalisten, Lehrer, Richter oder Bürokaufleute.
In diesen zwei Wochen habe ich die Welt mit anderen Augen erfahren. Früher war für mich Behinderung etwas, das ich akzeptiert habe, aber damit etwas zu tun haben wollte ich nicht. Ich habe gemerkt, dass die Kinder genau dieselben Probleme haben wie wir auch. Sie haben Liebeskummer, haben Streit mit den Eltern oder haben keine Lust auf Schule. Sie sind ganz normale Kinder. Aber was ist denn schon normal? Wenn ich jetzt in einen Bus steige und einen Behinderten sehe, muss ich schmunzeln. Alle Leute schauen sich hilflos um, anstatt zu fragen, ob man helfen kann. Die meisten Leute schauen gleichgültig in die Luft.
Da bin ich richtig stolz, wenn ich mich neben die Person setze, mit ihr rede oder einfach nur meine Hilfe anbiete. Diese zwei Wochen waren eine wichtige Erfahrung für mich, und ich weiß, wie viel sie mir auf meinem weiteren Lebensweg hilft. Alles in allem waren es für mich zwei wunderbare Wochen!"
Dieser Bericht, dem ich noch viele hinzufügen könnte, spricht für sich. Ich habe gedacht, wie schön wäre es, wenn das Schloss Ilvesheim und das Schloss Wieblingen so beieinander liegen würden, dass alle Schüler täglich ähnliche Erfahrungen sammeln könnten.
4. These: Es ist deutlich geworden, dass es nicht darum geht, ein vor neuzeitliches Wertesystem zu restaurieren, in dem die Mündigkeit des Menschen, seine Freiheit und Chance zur Selbstbestimmung, rückgängig gemacht werden, alte Bindungen einfach wieder hergestellt werden, und somit der Säkularisierungsprozess insgesamt diskreditiert wird. Legitim ist aber die Erwartung, dass insbesondere die Ursprungsgeschichte des Christentums Intentionen und Kriterien enthält, die heute von handlungsorientierender und gemeinschaftsbildender Relevanz sind. Es ist der Problemdruck der Gegenwart und zukunftsbezogener Richtungsorientierung, der die Aufnahme von Impulsen des christlichen Ethos akut werden lässt.
Beispiele solcher Richtungskriterien sind:
Die Aufforderung, Solidarität und Verantwortung für den Mitmenschen zu übernehmen; denn nur mit dem Mitmenschen gemeinsam kommt der Mensch zum Heil.
Die Berufung zur Freiheit und Mündigkeit emanzipiert vom heteronomen Umgang mit dem Gesetz und den Zwängen der Umwelt (Gal. 3,23-25,1).
Das Kriterium Dienst wird an die Stelle der Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Stelle der Gewalt (Mk. 10,42f) gesetzt.
Ebenso steht im Mittelpunkt die Hilfe für Schwache und Schutzbedürftige durch Aufrichtung des Rechts.
Diese Richtungskriterien entsprechen der Bewegung von Gottes Liebe in der Welt. Sie stehen in vielfacher Hinsicht im Widerspruch zu den vorherrschenden Tendenzen und Wertsystemen der Gegenwart. Gleichwohl bewähren die Christen und die christliche Gemeinde durch ihre Konkretisierung ihre spezifische Weltverantwortung. Es ist Aufgabe der Kirchen, solche Richtungskriterien in ihrer Gegenwart zur Geltung zu bringen und zugleich einem neuen Verständnis des Lebens, aber auch von Politik und öffentlichen Institutionen Nachdruck zu verleihen.
Der Glaube ist gestaltende Kraft, die von der Selbstkundgabe Gottes in Christus ausgeht und alle Dimensionen der Wirklichkeit berührt. Aufgabe der Christenheit, d.h. der Kirche, der Gruppen, der Einzelnen ist es, mit ihrer auf den Glauben bezogenen Vernunft ihre Lebenspraxis zu prüfen und so zu verändern, dass sie am besten den Intentionen des Glaubens entspricht und so das Gute verwirklicht.
Die Erfahrungen der weltlichen Wirklichkeit drängen widerständig, antagonistisch und oft undurchsichtig auf den Menschen ein und fordern sein Urteil, seine Stellungnahme und sein Handeln zur Weltveränderung heraus. In der christlichen Gemeinde und im Einzelnen stoßen diese Herausforderungen auf die Impulsivität des Glaubens und des von ihr geleiteten Gewissens. Dieser Zusammenstoß ist die Grunderfahrung christlicher Praxis; ihn methodisch zu durchdenken, ist Aufgabe der theologisch-ethischen Reflexion.
Evangelische Ethik wird vor dem Hintergrund des bisher Dargelegten als Ethik der Verantwortung zu charakterisieren sein. Soll der Begriff der Verantwortung nicht zur Leerformel erstarren, so bedarf es der lebendigen Willensbildung, um deutlich zu machen, wie in jeder Generation ein verpflichtendes Verständnis geweckt wird, was z.B. heute "Verantwortliche Elternschaft", "Verantwortliche Partnerschaft", "Verantwortung in der Wirtschaft" und in analogen Lebensbereichen bedeutet. Christliche Ethik sieht weder die menschlichen Verhältnisse, noch das Verhältnis von Mensch und Natur als ein selbstverständliches und harmonisches Gleichgewicht, sondern häufig als Felder von Konflikten, die durch die Schuld des Menschen verschärft werden. In diesen Konflikten sollen Menschen verantwortliche Konfliktregulierungen finden und verwirklichen. Dies gilt nicht zuletzt auch für den Umgang mit der Tierwelt, der häufig rücksichtslos selbstsüchtige Gewalt angetan und unnötige Opfer auferlegt werden, die ihre kreatürliche Angst steigert. Es gehört aber zur Verantwortung des Menschen, dass er der Kreatur in ihrer Angst und Not zum Helfer bei ihrem Freikommen von tödlicher Knechtschaft wird (vgl. Röm 8,19).
5. These: Wir sollten nicht übersehen, dass diese nur angedeuteten Richtungskriterien durchaus ihre innere Kraft und Tragfähigkeit erwiesen haben. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, enthält wesentliche Elemente der christlichen Ethik. Der Katalog der Grundrechte in unserem Grundgesetz von 1949 ist nicht nur kompatibel mit den christlichen Werten, sondern hebt diese in den Rang einklagbarer Rechte. Die in Art. 1 GG angesprochene Unverletzbarkeit der Würde des Menschen ist Auslegungskriterium für die gesamte Verfassung und bedarf der strengsten Interpretation und immer neuen Sinnerfüllung in jeder neuen Generation. Es ist wichtig, dass wir uns in der Diakonie den Sinn des Sozialstaatsgebotes (Art. 20, 28 und 14,1 usw. des Grundgesetzes) klar vor Augen führen. Die verfassungsmäßige Ordnung - und damit der gebotene Weg aller Politik - steht auf einem klaren ethischen Fundament. Sie richtet sich auf einen "Sozialstaat, der den Schwächeren hilft, der die Teilhabe an den wirtschaftlichen Gütern nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele ordnet, jedermann ein menschenwürdiges Dasein zu gewährleisten" (Hans. F. Zacher). Diese Interpretation war gewiss die "natürlichste". Sie entsprach der Nachfrage nach verfassungspolitischer Klärung, ob sich dieser Staat, dessen Grundrechte die Freiheit so ausführlich absicherten, doch auch aktiv um die reale Befindlichkeit der Menschen kümmere, ihnen Zugang zu den Gütern zu verschaffen, die sie brauchten, und die wirtschaftliche Abhängigkeit der einen von den anderen unter Kontrolle bringe - ob er ein Staat gegen die Not und für mehr Gleichheit der gesellschaftlichen, vor allem der ökonomischen Verhältnisse sei. Wir müssen heute sehr darauf bedacht sein, dass wir im Eifer der Reformen die Substanz dieses Sozialen Rechtsstaats bewahren und ihn aus einem vielleicht nur versorgenden in einen aktivierenden Sozialstaat weiterentwickeln. Neu ist die "Charta der Grundrechte der Europäischen Union", die - unter dem Vorsitz von Roman Herzog in einer hochrangigen Kommission formuliert - inzwischen ratifiziert und in die neue EU-Verfassung eingefügt worden ist.
Die Präambel lautet unter anderem:
"Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität.
Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.
Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei.
Die Grundwerte, auch wenn wir sie aus dem christlichen Glauben herleiten, entheben uns nicht der Notwendigkeit, in den unterschiedlichen Lebensbereichen: Individuelle Lebensführung, Partnerschaft, Familie, Erziehung, Arbeit und Wirtschaft, Gesundheit und medizintechnischer Fortschritt usw., zu Lösungen zu kommen, die der christlichen Verantwortung angemessen sind. Die EKD hat zu den meisten Themen in Denkschriften Stellung genommen und auch immer wieder Kontakt zur katholischen Kirche hergestellt. Herausragendes Beispiel ist das Sozialwort der Kirchen "Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit" (1997), in dem sie ein Bekenntnis zum Sozialstaat und zur sozialen Marktwirtschaft abgelegt haben und Vorschläge zur Reform und Konsolidierung unterbreitet haben. Dabei wurde dem Thema Arbeit und der Überwindung der Arbeitslosigkeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
6. These: Lassen Sie mich nun noch eine These zur Situation und Aufgabe kirchlich-diakonischer Arbeit mit Menschen mit einer oder mehreren Behinderungen zur Debatte stellen. Die katastrophale Situation in den kirchlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe 1945 führte dazu, der Wiederherstellung der alten Strukturen Vorrang vor einer grundsätzlichen Neubesinnung einzuräumen. In den sechziger Jahren wurden die entscheidenden Reformgesetze verabschiedet mit dem als Subsidiarität verstandenen bedingten Vorrang der freien Wohlfahrtspflege beim Ausbau und der Errichtung von Anstalten der Behindertenfürsorge. Es lag in der Natur der Entwicklung des Sozialstaats nach 1945, dass die stationäre Behindertenhilfe zunächst vorrangig eher nach zentralistischen Kriterien gefördert wurde, d.h. über die Bundesanstalt für Arbeit und die Landeswohlfahrtsverbände sowie über die Rentenversicherungsanstalten. Dies führte insbesondere bei der Rehabilitation zu einer umfassenden Förderung bestehender Einrichtungen, die eine bisher ungeahnte Blüte erlangten. Die Jahre von 1970 bis 1985 gelten als Zeit "geradezu stürmischer Entwicklung im Bereich der Hilfen für Menschen mit einer Behinderung". Die alten Einrichtungen wurden modernisiert und durch neue ergänzt. Es bildete sich insbesondere das in der Diakonie angesiedelte Netzwerk von Einrichtungen zur medizinischen, schulischen und beruflichen Rehabilitation sowie zur Ausbildung und Fortbildung von Fachkräften der Rehabilitation heraus. Die Zahl der hauptberuflichen MitarbeiterInnen in den Hilfeberufen verdreifachte sich. Auf diese keineswegs überraschende Tatsache machte der damalige Vorsitzende des "Verbandes Evangelischer Einrichtungen für geistig und seelisch Behinderte e.V.", Rektor Gerhard Brandt, bereits 1985 aufmerksam.
Die Jahre nach 1985 müssen demgegenüber eher unter dem Aspekt der Stagnation und Restriktion beschrieben werden. Die Krise hatte aber auch andere Ursachen. Mit der UNO-Dekade 1983-1992 wurde ein vollständig neues Verständnis von Behinderung gefördert. Der Chancengleichheit und vollen Teilhabe und Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung, sowie dem Abbau von "Handicaps", von Benachteiligungen - als kulturellen, materiellen und sozialen Schranken - wird Priorität eingeräumt ("Weltaktionsprogramm" und "Standardregeln" der UNO, entsprechend: EU-HELIOS-Programme). Die "Independent Living"-Perspektive formulierte folgende Leitbegriffe:
- Persönliche Assistenz statt Pflege und Betreuung,
- Anti-Diskriminierung als Abbau von aussondernden Barrieren,
- Entmedikalisierung als Aufhebung ärztlicher Dominanz,
- Entinstitutionalisierung als Weg zum selbstbestimmten Wohnen,
- Entprofessionalisierung als Bewusstsein, dass der Behinderte Experte in eigener Sache ist,
- Selbsthilfe und gegenseitige Beratung, d.h. Behinderte beraten Behinderte.
Ich habe die feste Überzeugung, dass gerade die Blinden- und Sehbehindertenverbände die damit verbundene Handlungsperspektive früher als viele andere kirchliche und nichtkirchliche Verbände praktiziert haben.
7. These: Im Hintergrund solcher Forderungen steht das Normalisierungsprinzip als Richtschnur, d.h. auch geistig behinderten Menschen soll unter Berücksichtigung individueller Belange genügend Spielraum zu einer relativ autonomen Lebensbewältigung und Daseinsgestaltung ermöglicht werden. Menschen mit Behinderung sollen nicht normalisiert werden, sondern es ist nach der Bedürfnislage jedes Einzelnen zu fragen. Praxisanleitende Funktion haben Gesichtspunkte, wie ein normaler Tagesrhythmus; die normale Differenzierung der Lebensbereiche; der normale Jahresrhythmus mit Feiertagen, Urlaub etc.; der normale Lebenslauf bezüglich des Lebensalters; normale Kommunikation und Respektierung der Bedürfnisse, auch in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern; normaler Lebensstandard. Dieses Prinzip muss auch als Richtschnur gelten für die Aktivitäten der Diakonie und jeglicher Wohlfahrtspflege. Dies muss nicht unbedingt zur Forderung nach "Heimverhinderung" oder "Heimauflösung" führen, wie sie Wolfgang Urban in seiner Schrift über "Wege zur Normalität" 1991 und später auch Klaus Dörner sowie neuerdings Johannes Degen erhoben haben. Aber deutlich ist, dass wir von den bisherigen Wegen der Hilfeleistung Abschied nehmen und neue Perspektiven gewinnen müssen.
Es ist erfreulich, dass der neue Bevollmächtigte des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union, Prälat Dr. Stephan Reimers, die Initiative ergriffen und im Vorfeld der Neuformulierung des SGB IX bezüglich der rechtlichen Stellung von Menschen mit Behinderung eine Expertenanhörung durchgeführt hat. Das Echo auf seine Einladung, das der ehemalige Diakonie-Landespfarrer in Hamburg, Stephan Reimers, erhalten hat, umschrieb er mit folgenden Worten - übrigens im Rahmen einer Predigt über Mk 5,24-34:
"Einige weisen selbstkritisch darauf hin, dass die Verwechslung des Wohles der Patienten mit dem Wohl und der Sicherheit der in der Diakonie Tätigen zu einem Entwicklungsstillstand geführt habe. Ein neues Hilfskonzept der Diakonie müsse sich verstehen als Assistenz auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Sonderwelten wie Anstalten und andere Großstrukturen gehörten aufgelöst. Selbst ein so populärer Slogan wie der von der "Hilfe zur Selbsthilfe" verwandelt sich unter dieser kritischen Sonde zu einer wertlosen Kleinmünze, weil er den Nachrang der Fremdhilfe gegenüber der Selbsthilfe nicht genügend deutlich mache."
Die Rechtsprechung hat mit der Novellierung des BSHG 1984 und später im §3 SGB XI zunächst virtuell, wenn auch noch nicht faktisch, den "Vorrang" ambulanter Hilfen gesetzlich festgelegt. Auch das Benachteiligungsverbot in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit der staatlichen Verpflichtung zum Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), sowie die Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) lassen eine wesentliche Einschränkung der Lebensmöglichkeiten und Selbstbestimmung behinderter Bürgerinnen und Bürger nicht zu. Hier ist nicht nur Phantasie angesagt, sondern hier müssen wir vor allem die Vorschläge, die aus den Verbänden der Betroffenen kommen, aufgreifen und umsetzen.
8. These: Die Diakonie befindet sich am Wendepunkt: Als weitaus größter Träger von stationären Einrichtungen in der Behindertenhilfe steht sie unter dem finanziellen und rechtlichen Schutz des "bedingten Vorrangs" der Freien Wohlfahrtsträger und wird gegenwärtig in eine Bewährungsprobe am Markt über Qualitätssicherung, Wirtschaftlichkeit und Sozialmanagement gestellt. Andererseits ist sie genötigt, dem dargelegten neuen Selbstverständnis mental und organisatorisch Rechnung zu tragen. Die zunehmend kritischen Anfragen nötigen zur theologischen Neubesinnung darüber, was "Hilfe für den Mitmenschen" ist und sein soll und zwingen dazu, über Hilfeformen in der Zukunft neu nachzudenken.
Zweifellos hat der Ausbau der Systeme sozialer Hilfen durch Planungsprozesse, berufliche Organisationen und Freisetzung ökonomischer Rationalität eine Gefahr heraufbeschworen: der professionelle Helfer wird zum Erfüllungsgehilfen vorgegebener Programme. Die Entscheidung zu helfen ist, wie Niklas Luhmann sagte, nicht Sache des Herzens, der Moral oder der Gegenseitigkeit, sondern, "der methodischen Schulung und der Auslegung der Programme, mit deren Durchführung man während einer begrenzten Arbeitszeit beschäftigt ist." Verbunden mit einem zunehmend spezialistisch verengten Zugriff auf die Probleme und Lebenslagen des Hilfsbedürftigen wird dieser unter Umständen von einer Mehrzahl von "Fachkräften" jeweils punktuell betreut. So gesehen steht heute soziale Hilfe in der Gefahr, einseitig in die Systemwelt eingebunden zu werden.
Deshalb drängt sich - nicht nur in der Diakonie - die Bemühung um eine neue sekundäre lebensweltliche Aneignung des Sozialen und der Solidarität unter den Bedingungen der Moderne außerhalb und unterhalb der Expertenkulturen auf. Allerdings gilt es, ein Missverständnis auszuräumen, nämlich das, es könne eine Systemwelt mit menschlichem Antlitz nicht geben. Die Bemühung, soziale Verantwortung zu reintegrieren in lebensweltliche Kontexte, soziale Kompetenz als Bildungsaufgabe zu begreifen, bedeutet weder einen Rückfall in deregulierte private Zuständigkeiten, noch einen Abbau sozialstaatlicher Hilfeleistungen. Es bedeutet aber, dass die Systemwelt die Lebenswelt nicht weiter kolonialisiert, sondern dass beide Wirklichkeiten sich lebendig aufeinander beziehen und so ihre Gemeinwohlverpflichtung erfüllen.
9. These: Die Diskussion um die Zukunft der Sozialarbeit bewegt sich heute auf einen Perspektivwechsel zu. Bislang wurde Sozialarbeit überwiegend erst dann tätig, wenn soziale Probleme der Betroffenen (Familien, Kinder, Jugendliche, Alte, Obdachlose, Arme) offensichtlich wurden. Soziale Dienste arbeiten professionell und problemorientiert meist an der Lösung von Einzelfällen. Trotz aller Ansprüche und bislang noch theoretisch gebliebener Handlungsprinzipien, nämlich offensiv, präventiv, aktivierend und strukturell verändernd tätig zu sein, ist soziale Arbeit bisher häufig nicht über Reaktions- und Lückenbüßerfunktionen hinausgekommen. Es fehlen längerfristige, sozialräumliche, umfassende und damit zielgruppenabhängige Lösungsansätze, z.B. durch Aufbau sozialer Netzwerke, die soziale Unterstützung sowohl in präventiver als auch kurativer und rehabilitativer Weise wirksam werden lassen. Zugleich müsste die einseitige Orientierung an professioneller Sozialarbeit zugunsten eines breiten Spektrums freiwilliger - von professionellen Kräften angeleiteter - sozialer Arbeit entwickelt werden.
Aus dieser erweiterten Perspektive entspringen eine Fülle neuer Aufgaben und Handlungsfelder für bürgerschaftliches Engagement und freiwillige soziale Dienste, nicht zuletzt auch für den Bereich des sozialen Lernens in unseren Ortsgemeinden. Damit würden wir auch einem Grundanliegen Wicherns Rechnung tragen, der an einer zentralen Stelle seiner Denkschrift festgestellt hat: "Ein neuer Schritt, der noch getan werden und verfolgt werden muss, ist: christliche Assoziationen der Hilfsbedürftigen selbst für deren soziale (Familie, Besitz und Arbeit betreffende) Zwecke zu veranlassen. Begibt sich die innere Mission erst ernsthaft an die Verwirklichung dieser Aufgabe, so ist der Grenzstein aufgerichtet zwischen der bisherigen und einer künftigen Epoche der christlich rettenden Liebesarbeit, ..." Wichern wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Bedürfnislage derer, die um Hilfe nachsuchen, im Mittelpunkt des Hilfehandelns stehen muss, denn wie Paolo Ricca sagte: "Diakonie ist in erster Linie Dienst an der Freiheit." Mit Dankbarkeit habe ich deshalb die Initiative des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienstes Baden e.V., eine "Helferbörse" einzuführen, zur Kenntnis genommen. Diese Initiative, die in der Schweiz schon zu großen Erfolgen geführt hat, verdient es, über das ganze Land ausgedehnt zu werden.
10. These: Aus diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden Gesichtspunkte, wo ich hoffe, dass in der Diskussion die Überlegungen direkt auf Ihre Erfahrungen im Blindendienst bezogen werden:
- Niemand kann fordern, professionelle Hilfe als ungeeignete, ja hinderliche Form hilfreicher Zuwendung, Assistenz und Betreuung zu begreifen. Wohl aber sind alle Formen professioneller Zersplitterung und Monopolisierung zu überwinden. C.W. Müller hat deshalb eher von einer zu schwachen und rudimentären Professionalisierung sozialer Berufe gesprochen. Bei aller Spezialisierung ist eine Neudefinition der Verantwortlichkeit erforderlich.
- Am Anfang aller Hilfe steht die mit dem Hilfesuchenden zu klärende Frage: Was braucht der Betroffene, um zu einem möglichst selbstbestimmten Leben zu gelangen? Danach richtet sich die Form der Hilfe sowie deren Umfang.
- Die Aufgabe der Professionellen ist es heute mehr denn je, lebensweltorientierte Hilfe zu leisten, und zwar in dem Umfang, in dem der Hilfsbedürftige um ganz konkrete Leistungen nachsucht. Hilfsbedürftig sei diejenige Person genannt, die nicht dazu in der Lage ist, einen erwünschten bzw. einen von ihr als wertvoll erachteten Zustand ihrer selbst oder ihrer Umwelt aus eigener Kraft zu erlangen und deshalb andere Personen bzw. Instanzen bittet, zur Erreichung des Ziels entsprechende Leistungen zu erbringen. Helfer sei diejenige Person bzw. Instanz genannt, die Willens und tatsächlich dazu in der Lage ist, der Bitte der hilfsbedürftigen Person zu entsprechen (nach Micha Brumlik).
- Die Bereitschaft zur Hilfe ist "schöpfungsgemäß" den Menschen mitgegeben. Sie kann allerdings verschüttet werden oder gefördert werden. Die Förderung im Sinne sozialen und diakonischen Lernens ist heute eine zentrale Aufgabe, die neu entdeckt wird.
- Diakonie und Kirche haben die Aufgabe, gegenüber den Tendenzen zur Ökonomisierung, Rationalisierung und Singularisierung die Erinnerung an die Wurzeln des universalen Hilfsethos der christlich-jüdischen Tradition wach zu halten und den interreligiösen Dialog darüber anzuregen.
Diakonie und Caritas sind heute herausgefordert, "Rechenschaft von der Hoffnung, die unter ihnen ist", so zu geben, dass sie hellhörig für neue Entwicklungen sind und neue Modelle sozialen Lernens und Handelns erproben. In einer so weit gespannten Hoffnungsperspektive sollte deutlich werden, dass Christsein heute Chance und Verpflichtung zugleich ist. Der "Dienst der Versöhnung" bildet die Basis unseres Christseins in der Welt und enthält zugleich die verbindliche Aufforderung, die Gaben jedes einzelnen zur vollen Geltung zu bringen und die Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens zu fördern.