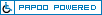Inhalt Mitte
Hauptinhalt
.Blinde und sehbehinderte ältere Menschen als besondere Zielgruppe unserer Arbeit - 5.
5.
Prof. em. Dr. Waldtraut Rath
Worin kann Lebensqualität bei Sehverlust im Alter bestehen, und wie können wir sie steigern?
Gliederung:
Teil I:
Lebensqualität und Bewältigungsstrategien im Umgang mit Sehverlust im Alter
1. Begrüßung, Vorstellung meiner Person
2. Kurzvorstellung der Befragungsgruppe
3. Lebensqualität - eine Einführung
4. Bewältigungsstrategien im Umgang mit Sehverlust im Alter
5. Problembereich: soziale Beziehungen
6. Problembereich: Einschränkungen
7. Fazit
Teil II:
Erschwernisse und Hindernisse beim Umgang mit dem Sehverlust
1. Informationsdefizit
2. Haltung zu Unterstützungsangeboten
3. Die Kompliziertheit der Verfahren
4. Mangel an Mobilität
Lösungsgedanken als Diskussionsanregungen
Teil I:
Lebensqualität und Bewältigung im Umgang mit Sehverlust im Alter
1. Begrüßung, Vorstellung meiner Person
- Wie komme ich als Pädagogin zu Themen der Alternsforschung?
Ausweitung der Bemühungen um Bildung und Förderung in der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik auf alle Altersstufen - "life-long-learning"; Nachfrage im Zuge der allgemeinen Öffnung der Hamburger Universität für ein Seniorenstudium; eigenes Lebensalter
- Welche Erfahrungen habe ich gesammelt?
Anleitung von einschlägigen Examensarbeiten im Rahmen des Blinden- und Sehbehindertenlehrerstudiums; Mitarbeit (wissenschaftliche Begleitung) bei Forschungsprojekten, z. B. zur Elementarrehabilitation in einem Hamburger Blindenaltersheim und Interviews zur Lebensqualität bei Sehverlust im Alter; Vorsitz in einem Verein, der sich professionell mit Lebenspraktischen Fertigkeiten bei älteren Menschen befasst; ehrenamtliche Betätigung in der Hospizarbeit (Sterbebegleitung)
- Wer waren meine Mitarbeiter und Helfer?
Auch bei regionaler Begrenzung kann die Arbeit in einem so komplexen Bereich wie Lebensqualität im Alter nicht von einer Person allein zufriedenstellend geleistet werden. Helferinnen und Helfer fand ich unter anderem in dem von Pamela Cory geleiteten Team des Hamburger Instituts für Rehabilitation und Integration Sehgeschädigter (IRIS) und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senator-Weiß-Hauses sowie bei den Bewohnern dieses Hamburger Seniorenheims für Blinde und sehbehinderte Menschen.
Die ganz spezielle Thematik des heutigen Themas "Lebensqualität bei Sehverlust im Alter" wurde gemeinsam mit Frau Christina Marquardt bearbeitet. Wir beide haben uns nicht nur theoretisch damit beschäftigt, sondern bewusst auch Betroffene als Gesprächspartner gesucht. Wir sehen sie als Experten an, kompetenter als jedes schlaue Buch. Frau Marquardt hat Interviews durchgeführt, ausgewertet und die Ergebnisse in einer Diplomarbeit (Psychologie) zusammengefasst. Da ihre Aussagen für die weitere Beschäftigung mit dem heutigen Thema wichtig sind, folgt eine Kurzvorstellung der Menschen, die Frau Marquardt interviewt hat, bevor ich mit Ihnen gemeinsam in das Fachliche einsteige.
2. Kurzvorstellung der Befragungsgruppe
Frau Marquardt fasst zusammen: "In meiner Arbeit habe ich Interviews mit drei Männern und sieben Frauen geführt, die jenseits ihres 60. Lebensjahres einen Sehverlust erlebt haben - alles also Personen, die nicht mit einer schon früher vorhandenen Sehbehinderung gealtert sind, sondern erst zu einem späteren Lebenszeitpunkt damit konfrontiert waren - was ja einen erheblichen Unterschied macht. Das Alter der teilnehmenden Personen lag zwischen 60 und 93 Jahren; drei Teilnehmerinnen gehörten zu den so genannten "Hochbetagten" (älter als 80).
Ausmaß, Art und Ursache der Sehverluste waren bei den Teilnehmern verschieden: Bei der Hälfte war der Sehverlust infolge einer chronischen Erkrankung (z. B. Diabetes) allmählich aufgetreten, bei den anderen infolge eines akuten Krankheitsereignisses (z. B. Schlaganfall) ganz plötzlich. Das Spektrum reichte von einer langsam entstandenen mittelgradigen Sehbehinderung bis zur plötzlichen totalen Erblindung. Es handelte sich also um eine insgesamt sehr bunte Gruppe von Personen - dies gilt auch für ihre sonstigen Lebensbedingungen wie Wohnort, Beruf, Bildungsstand.
In den Gesprächen haben die Interviewpartner mir davon erzählt, was sie seit Beginn ihrer Sehschädigung erlebt haben, welche Probleme sich ihnen stellten und wie sie ihre Situation bewältigt haben - oder auch nicht. Dabei habe ich relativ wenig Fragen gestellt, sondern meinen Gesprächspartnern viel Raum und Zeit gegeben, damit sie mir das erzählen konnten, was sie für wichtig hielten. Aus dem breiten Spektrum der Aussagen kann ich natürlich nur Auszüge vorstellen. Dabei habe ich Namen aller Personen, die hier genannt werden, aus Gründen der Anonymität geändert."
Nun zum Thema "Lebensqualität bei Sehverlust im Alter" und der Anschlussfrage: "Wie können wir sie erhalten oder gar steigern?"
Wir beginnen mit einigen einführenden Worten zum Begriff Lebensqualität.
3. Lebensqualität - eine Einführung
Lebensqualität - was ist das eigentlich? Auf jeden Fall ein Modewort, das uns heute fast überall begegnet: in der Werbung, in politischen Diskussionen, in Wissenschaften wie der Pädagogik, Medizin, Psychologie und Soziologie. Überall wird eifrig über Lebensqualität diskutiert, aber es gibt keinen Konsens darüber, wie man diesen Begriff definieren könnte.
Eines ist unstreitig: Lebensqualität ist vielschichtig, es gehören dazu unterschiedliche Bereiche - man spricht auch von Lebensqualitätsdimensionen. Übereinstimmend werden die meisten Menschen hierzu wohl die Bereiche Gesundheit, soziale Eingebundenheit und ausreichende materielle Sicherheit zählen. Aber: Nicht alles ist für jeden gleich wichtig, und für die Lebensqualität mancher Menschen sind ganz spezielle Bereiche besonders bedeutsam, bestimmte Hobbies zum Beispiel, die für andere Menschen überhaupt keine Rolle spielen. Lebensqualität bedeutet nicht für alle Menschen dasselbe, sondern für jeden Einzelnen etwas Individuelles, Persönliches. Das muss man sich klarmachen, wenn man über Lebensqualität spricht: Wenn wir beurteilen wollen, wie gut oder schlecht die Lebensqualität z. B. bei einem Menschen ist, der im Alter sein Sehvermögen verliert, dann müssen wir diesen Menschen danach fragen und uns intensiv mit ihm befassen. Nur der Betroffenen selbst kann umfassend Auskunft über seine Lebensqualität geben.
Und noch etwas ist zu bedenken - Lebensqualität hat zwei Seiten: eine äußere und eine innere. Was ist gemeint? Das ist eine alte Frage, über die man schon in der Antike nachgedacht hat. Bereits vor 2000 Jahren hat z. B. der griechische Philosoph Aristoteles zwei Faktoren benannt, die zum Glücklich-Sein eines Menschen beitragen: das Glück von außen im Gegensatz zu dem Glück von innen. Er meinte, dass zu einem guten Leben günstige äußere Bedingungen gehören, z. B. ein schönes Haus, genug zu essen und zu trinken, eine heile Familie und eine friedliche Lebensumwelt. Genauso gehöre zu einem guten Leben aber Glück von innen, z. B. Dankbarkeit, Zufriedenheit, die Erfahrung von Liebe.
Diese Auffassung wird noch heute in der aktuellen Fachdiskussion um Lebensqualität vertreten. Denn es hat sich gezeigt, dass man nicht nur an äußeren Umständen die Lebensqualität eines Menschen festmachen kann. Was nützt es, wenn ein Mensch vielleicht reich ist, ein schönes Haus bewohnt, körperlich fit ist - und trotzdem fühlt sich dieser Mensch unglücklich, vermisst etwas, ist unzufrieden? So jemand hat - auch wenn wir das von außen vielleicht anders vermuten würden - keine hohe Lebensqualität. [Die Forschung spricht bei solchen Phänomenen übrigens von Unzufriedenheitsdilemma.] Umgekehrt gibt es Menschen, deren Lebensbedingungen von außen eher schlecht erscheinen, die aber trotzdem zu einem Gefühl der Zufriedenheit und Dankbarkeit gefunden haben. [Auch hierfür hat die Wissenschaft eine Namen: Zufriedenheitsparadox.] Vielleicht haben auch Sie schon einmal die Beobachtung gemacht, dass gerade Menschen, die viel Schweres und Trauriges in ihrem Leben durchmachen mussten, zu einer solchen positiven Lebenshaltung gefunden haben.
Das mag etwas damit zu tun haben, dass man an schweren Erfahrungen auch wachsen und in der Persönlichkeit reifen kann.
Lebensqualität - so kann zusammengefasst werden - ist ein sehr komplexes und individuelles Gebilde. Sie wird also einerseits dadurch bestimmt, wie eine Situation objektiv - von außen betrachtet - ist, andererseits aber auch dadurch, wie ein Mensch seine Situation subjektiv wahrnimmt, wie er sie bewertet, was er im Geiste damit macht.
An drei Beispielen aus der Arbeit von Christina Marquardt soll das bisher Gesagte verdeutlicht werden.
Als Erster wird Herr Seidler vorgestellt: Herr Seidler ist 77 Jahre alt. Seit 8 Jahren hat er eine fortschreitende Makuladegeneration, heute ist er nicht mehr in der Lage zu lesen oder sich draußen ohne Begleitung frei zu bewegen. Für Herrn Seidler ist der Sehverlust im Alter ein schwerer - und vor allem ungerechter - Schicksalsschlag, denn er ist der Meinung, in seinem Leben viel Leid und Schweres erlebt zu haben, und er fühlt sich vom Schicksal verraten, das ihm nun auch noch diese Last aufgebürdet hat. Immer wieder fragt er sich, warum das geschehen ist und womit er es verdient hat. Er ist nicht in der Lage, diese Ungerechtigkeit zu akzeptieren. Er sagt: "Ich habe die Krankheit nicht akzeptiert und befinde mich in einer gewissen Resignation. Aber ich versuche eben, mit dieser Resignation so gut wie möglich zu leben."
Herr Seidler lehnt strikt alles ab, was eine Identifikation mit seiner Sehbehinderung bedeuten würde: Er würde z. B. niemals einen Langstock benutzen, an dem man ihn draußen auf der Straße als sehbehindert erkennen könnte. Und auch mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein möchte er nichts zu tun haben! Seine emotionale Verfassung ist nach seinen eigenen Worten eine "unaufhörliche Chronologie des Leidens", geprägt von der ständigen Sehnsucht, wieder sehen zu können. Seine Lebensqualität ist - nach seinen Worten - "hinüber".
Ein etwas anderer Fall ist Frau Brandt: Sie ist vor zwei Jahren (mit 68) an einem Schlaganfall nahezu vollständig erblindet. Sie beschreibt ihre Haltung dazu wie folgt: "Es ist verflixt schwer, so zu leben und es zu akzeptieren wohl noch schwerer. Ich habe es akzeptiert - aber nur für den Moment, nicht für immer. Für immer gibt's so was nicht." Frau Brandt ist überzeugt, dass sie wieder sehen können wird - obwohl aus medizinischer Sicht eine Verbesserung ihres Sehvermögens ganz unwahrscheinlich ist. Ihre Überzeugung geht so weit, dass sie sich weigert, das Wort blind auszusprechen - sie buchstabiert es: b - l - i - n - d . Die Hoffnung, wieder sehen zu können, gibt Frau Brandt Kraft - aber sie hindert sie auch daran, sich mit ihrer gegenwärtigen Situation auseinander zu setzen.
Der dritte Fall liegt ganz anders: Herr Rustig ist vor drei Jahren ebenfalls an einem Schlaganfall vollständig erblindet. Als das geschah, war er 74. Von den drei Personen, die Ihnen gerade vorgestellt werden, hat er die stärkste Sehbeeinträchtigung. Nach einer tiefen Krise, die mit Verzweiflung und Selbstmordgedanken verbunden war, hat Herr Rustig sich selbst vor eine Entscheidung gestellt: entweder Schluss machen - oder das Leben so, wie es jetzt ist, annehmen und etwas daraus machen. Er entschied sich, es erst einmal mit dem Leben zu versuchen. Er meinte: "Schluss machen kannste immer noch damit, wenn das wirklich so schlimm ist."
Das war allerdings nicht mehr nötig, denn im Laufe der Zeit stellte Herr Rustig fest, dass Blind-Sein nicht so war, wie er es zuerst befürchtet hatte: "Zuerst hab ich gedacht, nun bist Du ein richtiger Krüppel. [...] Ich bin gar nicht unzufrieden. Unzufrieden war ich mal, aber im Moment kann ich nicht sagen, dass ich unzufrieden bin." Herr Rustig hat drei Jahre nach seiner Erblindung seine Lebensqualität wieder hergestellt - zum Teil sogar gesteigert.
Diese Personen wurden Ihnen nicht vorgestellt, um ihr Erleben und Handeln zu bewerten und etwa zu sagen "So muss man es machen und so nicht!" Das steht uns als Projektbeteiligten auch nicht zu! Es ging hier nur darum aufzuzeigen, wie unterschiedlich das Eintreten einer Behinderung - unabhängig von ihrem Ausmaß - erlebt und verarbeitet werden kann.
Einige Interviewpartner waren auch nach vielen Jahren nicht in der Lage, ihre Behinderung - zumindest teilweise - zu akzeptieren als etwas, was zu ihrem Leben und zu ihnen selbst gehört. Sie wollten sich möglichst wenig mit der Situation des "Behindert-Seins" auseinandersetzen. Deshalb waren sie für Angebote - wie z. B. Unterricht in Orientierung und Mobilität oder Kontakt zu anderen sehgeschädigten Menschen - nicht aufgeschlossen. Sie waren gewissermaßen "blockiert", was die Bewältigung ihrer veränderten Lebenssituation betraf.
4. Bewältigungsstrategien im Umgang mit Sehverlust im Alter
Im Folgenden werde ich Ihnen darüber berichten, welche Wege im Umgang mit ihren Behinderungen Frau Marquardts Interviewpartner gegangen sind, und welche Bewältigungsstrategien sie angewendet haben, um ihre Lebensqualität zu erhalten.
Um möglichst viel zu diesem Thema zu erfahren, hat Frau Marquardt einen kleinen Trick angewandt: Sie hat immer am Ende des Interviews die 'Ratgeberfrage' gestellt, die lautete: Wenn sie einen Ratgeber schreiben würden für Menschen, die so etwas wie Sie durchmachen, was würden Sie hineinschreiben?
Auf diese Frage wurde erstaunlich unterschiedlich reagiert. Manche waren ganz begeistert und hatten sofort etwas dazu zu sagen. Aber die meisten waren erst einmal verhalten und gaben Antworten wie: "Wenn ich auch schon selber für mich kaum sehe, was eine Verbesserung der Situation bringen könnte, dann kann ich auch anderen nicht raten." Entgegen solcher Behauptungen gaben doch fast alle Befragten letztlich sehr ausführliche Antworten, und manche riefen sogar Tage später bei Frau Marquard zu Hause an, weil ihnen zu der Ratgeberfrage noch etwas eingefallen war. Offensichtlich wussten die Gesprächspartner teilweise selbst gar nicht, dass sie wirklich Experten zum Thema "Lebensbewältigung mit einem Sehverlust" waren. Sie mussten erst eine Weile nachdenken, bis ihnen das auffiel ...
Ein Stichwort, das in sehr vielen Antworten vorkam, lautet: Verantwortung. Als ganz wichtig wurde angesehen, die Verantwortung für die eigene Lebenssituation zumindest teilweise selbst zu übernehmen und das Behindert-Sein als eine Art Herausforderung zu begreifen, der man sich stellen muss. Frau Brandt sagt: "Das würde ich jedem gern mitgeben: Stellen Sie sich der Aufgabe, wenn Ihnen so etwas widerfahren ist wie mir. [...] Denn mir ist ja eine Aufgabe gestellt worden. So seh' ich es."
Es ist ganz klar, dass es nicht immer einfach ist, sich solch einer Herausforderung zu stellen, und ohne Rückschläge und Enttäuschungen wird es wohl auch nicht gehen. Oft wurde berichtet, wie viel Disziplin und Selbstbeherrschung notwendig sind, um immer wieder die nötige Kraft und den Mut zu finden. Manchmal muss man sich auch einfach von sich selbst und dem eigenen Kummer ablenken, Unterhaltung suchen, sich für andere Menschen interessieren. Herr Moor, der mit 60 Jahren schlagartig erblindet ist, sagt: "Man muss immer darauf achten, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt."
Wenn Sie das hören, merken Sie wahrscheinlich schon, dass die Interviewpartner hohe Ansprüche an sich selbst stellen - Disziplin, Selbstbeherrschung, sich nicht zu wichtig nehmen ... Aber dazu gibt es natürlich auch eine Gegenseite, denn niemand ist in der Lage, immer diszipliniert und selbstbeherrscht zu sein - und das wäre wahrscheinlich auch gar nicht besonders gut. So gibt Herr Moor zu: "Wissen Sie, ab und zu geht auch mal eine Träne auf Reisen. Dann sitze ich auf dem Sofa und bin einfach nur unglücklich und will gar nichts. Das muss dann einfach raus ...
Und hinterher geht es wieder etwas besser." Und Frau Brandt berichtet, dass sie manchmal Wutausbrüche bekommt, bei denen sie laut schimpft und flucht und mit den Türen knallt. "Das muss raus, und das befreit kolossal!" sagt sie.
Auch traurige und schwierige Gefühle gehören zu einem Bewältigungsprozess dazu; sie sind wichtig und müssen Raum bekommen.
Sie sollten nur nicht allein stehen und das ganze Gefühlsleben beherrschen. Etwas, was hierbei von vielen Gesprächspartnern als hilfreich hervorgehoben wird, ist: Humor. Das Vermögen, nicht immer alles zu ernst zu nehmen und an angemessener Stelle mal über sich selbst oder andere herzlich zu lachen, kann viele Situationen entschärfen. Sie glauben gar nicht, wie oft während der Gespräche Lachen erklang, wenn Geschichten erzählt wurden, wie z. B. von Herrn Rustig, der nach seiner Erblindung unbedingt noch Fahrrad fahren wollte. Seine Frau musste laut redend und singend vor ihm her fahren, und er hat versucht, ihr zu folgen. Leider landete er dann doch im Graben und gab das Unternehmen auf ... Und Herr Moor wurde immer wieder von seiner Frau mit kleinen Tricks zum Lachen gebracht, z. B. als sie seine Bonbondose gegen eine Dose mit Nivea-Creme ausgetauscht hatte...
Eine Bewältigungsstrategie ist besonders beeindruckend. Es handelt sich um die Strategie, die eigene Wahrnehmung auf Positives zu richten, anstatt sich die erlittenen Verluste bewusst zu machen. Mit den Worten "positiv denken und das Gute sehen" beschreibt Frau Lohbe diese Strategie. Herr Rustig erläutert das am Beispiel einer duftenden Blume: Er kann sich darüber freuen, wie schön die Blume duftet - anstatt zu betrauern, dass er die Blume nicht mehr sieht. Genauso kann er sich auf Lebensbereiche konzentrieren, die er auch mit der Sehbehinderung noch gut ausführen kann - Gespräche mit Freunden und Verwandten führen, ausgedehnte Spaziergänge mit seiner Frau unternehmen, und mit Hilfe einer sprechenden Küchenwaage gelingt es ihm sogar, seinem Hobby des Kuchenbackens weiterhin nachzugehen.
Herr Rustig macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass seine Erblindung ihm gar nicht nur Verluste, sondern auch Gewinne gebracht habe. Er erzählt von der Entdeckung neuer, faszinierender Sinneseindrücke, z. B. hätte er früher nie geahnt, "wie gut das Moor riecht ...!" Außerdem habe er zwar äußerlich einige Freiheiten verloren - aber auch innerlich einige gewonnen: Wenn sehende Menschen einfach nur spazieren gingen, würde er in seinen Gedanken mal eben nach New York reisen!
Herr Rustig steht mit seinen Beobachtungen nicht allein. Mehrere Interviewpartner berichten, dass sie sich durch die Sehschädigung persönlich zu ihrem Vorteil verändert hätten, z. B. ganz andere Dinge wichtig nähmen als früher, gute Freunde und liebe Verwandte mehr zu schätzen wüssten, sich an Kleinigkeiten mehr erfreuen könnten. Die 88-jährige Frau Lohbe spricht von einer inneren Ruhe, die sie gefunden habe, weil sie aus der Hektik des Alltags herausgerissen sei und mehr Muße zum Nachdenken finde. Und außerdem, so fügt sie hinzu, sei es auch manchmal ganz gut, wenn man nicht immer alles so genau sehe. Es sei wahrlich nicht alles auf der Welt schön anzusehen!
Diese Schilderungen der Interviewpartner beeindrucken beim Hören oder Lesen. Es ist doch erstaunlich, wie viel man aus einer schwierigen Situation machen kann, allein schon dadurch, dass man ihr innerlich aufgeschlossen begegnet und bereit ist, trotz Schwierigkeiten das Gute und Schöne zu entdecken und zu würdigen.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass alle Bewältigungsformen, von denen bisher berichtet wurde, sich vornehmlich im Innern der Gesprächspartner abspielten - in ihren Gedanken, ihren Gefühlen, ihrer Wahrnehmung. Bewältigung - das ist dadurch vielleicht noch einmal deutlich geworden - beginnt wirklich in unseren Köpfen. Nun gibt es manche Wissenschaftler, die meinen, dass bei alten Menschen, die oft in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind (z. B. weil ihr Gesundheitszustand nicht mehr so gut ist), Bewältigung nicht nur im Kopf anfängt, sondern auch im Kopf aufhört. Sie meinen, ältere Menschen könnten ihre Situation meistens nicht mehr aktiv verändern, und deshalb müssten sie die Situation so, wie sie ist, akzeptieren, ihre Ansprüche senken und sich mit Einschränkungen abfinden.
Dieser Auffassung stimmten die an Frau Marquardts Projekt Beteiligten nicht zu. Im Gegenteil: Uns beeindruckte immer wieder die Energie und der Einfallsreichtum, mit dem viele Interviewpartner ihre Situation aktiv in die Hand nahmen und veränderten. Die Beispiele hierzu sind so vielfältig, dass hier natürlich nur Auszüge daraus vorgestellt werden können. Ergänzend werden Bemerkungen hinzugefügt aus dem Buch von Dr. Hans-Eugen Schulze: "Nicht verzagen, sondern wagen. Praktische Hilfen für Altersblinde und ihre Angehörigen". Dieser Ratgeber enthält viele hilfreiche Anregungen.
5. Problembereich "soziale Beziehungen"
Zwei Problembereiche werden in nahezu allen Interviews als besondere Herausforderung bei der Bewältigung angesprochen. Der eine betrifft die sozialen Beziehungen, die unter der Behinderung leiden. Oft ziehen sich die behinderten Menschen von anderen zurück, weil ihnen soziale Begegnungen nicht mehr so angenehm sind wie früher. Sie haben z. B. Angst, in peinliche Situationen zu geraten (beim Essen kleckern), es ist ihnen unangenehm, ihr Gegenüber nicht genau erkennen zu können. Wenn dann noch eine andere Behinderung, etwa eine Hörbehinderung, dazu kommt, sind die Bedingungen doppelt erschwert.
Manchmal ziehen sich aber auch gar nicht die behinderten Menschen zurück, sondern die Nichtbehinderten tun dies - aus Unsicherheit, weil sie keine Fehler machen wollen oder nicht wissen, wie sie mit "dem Behinderten" umgehen sollen.
Die Interviewpartner betonen immer wieder, wie wichtig es ist, solchen Tendenzen entgegen zu wirken und eine soziale Isolation zu verhindern. Das kann bedeuten, soziale Kontakte bewusst und aktiv aufrecht zu erhalten bzw. neue Kontakte zu suchen, auch wenn dabei eigene Unsicherheiten und Ängste überwunden werden müssen. Als hilfreich werden oft Kontakte zu ebenfalls behinderten Menschen hervorgehoben.
Meistens ist es sehr wichtig, nichtbehinderte Freunde und Verwandte über die eigene Behinderung aufzuklären und zu informieren. Herr Dr. Schulze schreibt an die Adresse der Sehgeschädigten. "Es ist Ihre Aufgabe, aus der Erfahrung, die Sie inzwischen gesammelt haben, Sehenden zu sagen, wie sie mit Ihnen umgehen sollten und wie nicht." Tatsächlich können viele Schwierigkeiten im sozialen Bereich dadurch gelöst werden, dass nicht etwa die nichtbehinderten Menschen den behinderten helfen, sondern umgekehrt - die Behinderten ihren Wissens- und Erfahrungsvorsprung nutzen, um den Nichtbehinderten das Miteinander zu erleichtern. (Dies gilt natürlich für Hörbehinderungen ebenso, wie überhaupt für alle Behinderungen.)
6. Problembereich: Einschränkungen
Der zweite Problembereich, der in allen Interviews thematisiert wurde, lautet: Einschränkungen. Einschränkungen als Folge der Behinderung berühren ja die verschiedensten Lebensbereiche: Die Bewegungsfreiheit wird geringer, viele Tätigkeiten sind nur noch unter größten Mühen oder gar nicht mehr möglich (besonders häufig angesprochen: Lesen). Weitere Beispiele erübrigen sich hier, wahrscheinlich fällt jedem von Ihnen hierzu eine Menge ein.
Einer der Interviewpartner formuliert sein Motto zu diesem Problembereich wie folgt: "Alles, was man noch irgendwie machen kann, sollte man auch machen. Je länger das mit der Erblindung her ist, desto wohler fühle ich mich, weil ich immer mehr lerne."
Und passend hierzu heißt es im Ratgeber von Herrn Dr. Schulze: Ein Mensch, der erblindet ist, sollte sich nicht immerfort fragen: "Kann ich das noch?", sondern vielmehr. "Wie muss ich es anpacken, damit ich es noch kann?"
In den Interviews wurden viele verschiedene Mittel und Wege beschrieben, um Dinge noch zu tun, die zunächst unmöglich erschienen. Manche Einschränkungen lassen sich dadurch kompensieren, dass verstärkt andere Sinne eingesetzt werden, das Gehör, soweit dies möglich ist, und natürlich der Tastsinn, der an so vielen Punkten wichtig wird - beim Abwaschen, beim Rasieren, beim Unkrautjäten - in einem Interview heißt es "Man lernt, mit den Fingern zu denken."
Manchmal leisten spezielle Hilfsmittel für Sehgeschädigte gute Dienste - seien es Haushaltswaagen mit Sprachausgabe oder mit tastbarer Anzeige, seien es Lesegeräte, die Schrift extrem vergrößern können - die Auswahl an Hilfsmitteln ist mittlerweile wirklich beachtlich - und viele davon sind auch mit einer zusätzlichen Hörbehinderung gut nutzbar.
Noch größer allerdings ist die Auswahl an individuellen Tricks und Kniffen, die jeder Einzelne der Gesprächspartner für sich entwickelt hat, um das Alltagsleben so gut und selbstständig wie möglich zu meistern. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt - da werden Seile als Orientierungshilfe quer durch die Wohnung gespannt - oder auch quer durch das Gemüsebeet, um die Gartenarbeit zu erleichtern. Frau Frohmut hat sich Boule-Kugeln in besonders grellen Farben gekauft und so lange und intensiv geübt, dass sie trotz ihrer Sehbehinderung zu den besten Spielerinnen in ihrem Boule-Club zählt. Und Frau Last lernt mit 93 Jahren, einen Kassettenrekorder zu bedienen, dessen Tasten mit bunten Farbpunkten markiert sind - und dies, obgleich sie immer einen Widerstand gegen technische Geräte hatte. An dieser Stelle könnten noch unzählige Beispiele für solche Strategien aufgezählt werden, mit denen die Gesprächspartner ihre Alltagsschwierigkeiten in den Griff bekommen haben. In den Gesprächen wurde immer wieder spürbar, wie wichtig und befriedigend es ist, wenn es gelingt, sich Teile seiner Handlungsfreiheiten dadurch zurück zu erobern, dass man "erfinderisch" ist, wie Herr Dr. Schulze es nennt. Und über die eigenen Erfindungen hinaus ist es auch möglich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, z. B. die Angebote der "Elementarrehabilitation", also Trainings in Orientierung und Mobilität [die in der Regel von der Krankenkasse finanziert] sowie in lebenspraktischen Fertigkeiten, die speziell für sehgeschädigte Menschen entwickelt wurden. Leider wird von dieser Möglichkeit gerade in der Gruppe der alten Menschen mit einem Sehverlust nur selten Gebrauch gemacht.
Ein Aspekt sei zum Schluss noch angesprochen: Bei dem Bemühen, sich seine Handlungsmöglichkeiten und Selbständigkeiten zu erhalten, kann es auch mal notwendig sein, sich gegen die wohlmeinende Hilfsbereitschaft oder gegen die Ungeduld Sehender durchzusetzen. Herr Dr. Schulze schreibt dazu: "Nehmen Sie getrost Hilfe in Anspruch, wo es nötig ist, aber versuchen Sie auch, soviel wie eben möglich allein zu tun ... Lassen Sie sich von niemandem die Freude nehmen, wieder etwas allein tun zu können, und von niemandem einreden, Sie könnten etwas nicht." Dieser Rat ist ein guter Schluss für den Bericht über die Bewältigungsstrategien der Interviewpartner des Projektes.
7. Fazit
Der Versuch, aus allem, was Ihnen vorgetragen worden ist, ein Fazit zu ziehen, lässt deutlich werden:
Die Auseinandersetzung mit einem Sehverlust (oder einer anderen Behinderung) mit dem Ziel, die eigene Lebensqualität zu erhalten, bedeutet, in beträchtlichem Ausmaß Neues dazu zu lernen sowie sich selbst und seine Umwelt zu verändern. Wenn vorhandene Möglichkeiten, die eigene Lebenssituation zu verbessern, nicht genutzt werden, kommt es leicht zu Resignation und Unzufriedenheit. Das ist die eine Seite.
Die andere Seite ist: Die Auseinandersetzung mit einem Sehverlust im Alter (oder einer anderen Behinderung) bedeutet, Akzeptanz und Bereitschaft, von vielem, was früher wie selbstverständlich zum Leben dazugehörte, Abschied zu nehmen. Es gibt eben auch Konsequenzen eines Sehverlustes, die sich nicht verändern lassen und die man schlichtweg hinnehmen muss. Wer dazu nicht in der Lage ist, wird ebenfalls unzufrieden sein. Wichtig für den Erhalt der Lebensqualität ist, dass eine ausgewogene Balance gefunden wird zwischen diesen beiden Strebungen: Gegenan-Gehen und Verändern auf der einen Seite, Akzeptanz und ein gewisses Sich-Fügen in ein Schicksal auf der anderen Seite. Jeder muss und darf sich hier seinen eigenen Weg suchen, seinen eigenen Balanceakt vollführen. Denn es gibt viele individuelle Wege, die trotz Behinderungen und anderen Einschränkungen zu einer hohen Lebensqualität im Alter führen können.
Teil II:
Erschwernisse und Hindernisse beim Umgang mit dem Sehverlust
Vorbemerkung: Im Folgenden wird über Aspekte gesprochen, die sich als problematisch und hinderlich bei der Auseinandersetzung mit dem Sehverlust herausgestellt haben. Dabei wird nicht auf die individuelle Problematik des Einzelnen eingegangen, sondern auf das, was viele oder alle Befragten erwähnt haben.
Vier wesentliche Aspekte werden vorgestellt.
1. Informationsdefizit
Alle Interviewten betonten, gar nicht oder nur spärlich über Unterstützungs- und Hilfeangebote für Sehgeschädigte informiert worden zu sein. Problematisieren muss man in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle der Augenärzte, denn sie sind diejenigen, durch deren Hände sozusagen alle Betroffenen gehen und denen oft Vertrauen und Respekt entgegengebracht werden - mindestens zuerst.
Viele Augenärzte fühlen sich zwar zuständig für die Heilung oder wenigstens Minderung eines Sehverlustes, nicht jedoch für die Frage wie man am Besten damit lebt. Nur Ausnahmsweise erhielten Patienten von ihren Ärzten Hinweise darauf, dass und wo man Unterstützung hierfür finden kann. Ein Extrembeispiel ist das Verhalten des Augenarztes einer Frau, die zur Sehhilfenberatung beim Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein gehen wollte. Diese Beratung wird bei Zustimmung durch den Augenarzt von der Krankenkasse bezahlt. Der Arzt zerriss das zugehörige Formular, das die Frau mitgebracht hatte, mit den Worten: "Das ist alles Schnickschnack!". Dies ist sicherlich ein Extrem, und es können nicht alle Ärzte über einen Kamm geschoren und zum Buhmann gemacht werden. Dennoch scheint hier ein erheblicher Aufklärungs- und Veränderungsbedarf zu bestehen - und generell muss darüber nachgedacht werden, wie der Zufluss von Informationen und Kontaktadressen verbessert werden kann.
2. Haltung zu Unterstützungsangeboten
Viele der Gesprächspartner hatten gegenüber vorhandenen Angeboten - und hiermit sind vor allem die Angebote der Elementarrehabilitation, sowie spezielle Angebote der Blinden- und Sehbehindertenvereine gemeint - eine ablehnende Haltung, sofern sie über diese informiert waren.
Dies hatte im Wesentlichen zwei Gründe:
Bei einigen hat es etwas mit dem bereits in Teil I geschilderten Problem zu tun, sich nicht mit dem Sehverlust identifizieren zu können oder zu wollen. "Angebote der Rehabilitation sind Angebote für Blinde oder für Hilfsbedürftige, und dazu möchte ich nicht gehören" - so könnte man den Tenor zusammenfassen. Einige dagegen haben bereits Erfahrungen mit Unterstützungsangeboten gemacht und diese als negativ oder zumindest nicht hilfreich erlebt. Dahinter steckt der Eindruck, dass die Angebote nicht für die eigene Person bzw. für die eigenen Bedürfnisse passend sind: Ein Mann besucht eine spezielle Kureinrichtung für Erblindete und trifft dort, nach seinen Worten, "nur auf klapprige Leute, die nicht einmal mehr richtig laufen wollten". Das Angebot sei dementsprechend gewesen. Das, was er gerne gelernt hätte, habe er dort nicht lernen können. Sehr viel Kritik wird deutlich an Angeboten der Ergotherapie: Mehrere Interviewpartner, Männer wie Frauen, berichten geradezu entrüstet, sie hätten Körbe flechten sollen, "weil man das als Blinder wohl so macht", aber sie hätten weder gewusst, wozu, noch, was sie mit den vielen Körben dann hätten anfangen sollen! Sie hätten gern gelernt, wie sie zu Hause in ihrer Wohnung klarkommen können. Auch relativ wenig Interesse bestand an Gesprächskreisen oder Selbsthilfegruppen für Sehgeschädigte: Man wolle nicht nur unter Sehbehinderten sein und schon gar nicht ständig über sich und seine Probleme reden.
Deutlich wird an solcher Kritik, dass die Angebote, die die Interviewpartner kennen gelernt haben, ihren individuellen Bedürfnissen offenbar nicht gerecht wurden. [Das heißt natürlich nicht, dass diese Angebote grundsätzlich nichts taugen - nur eben nicht für bestimmte Personen.] Immer wieder wiesen Äußerungen auch darauf hin, dass sie sich mit ihrer Situation und ihren Bedürfnissen nicht ernst genommen fühlten bzw. niemand sich eingehend danach erkundigt habe, was sie denn überhaupt wünschten und benötigten. Menschen, die noch nicht bereit sind, sich mit ihrem Sehverlust zu identifizieren, fallen aus dem Unterstützungssystem quasi ganz heraus.
3. Die Kompliziertheit der Verfahren
Ein Punkt, an dem viele Bemühungen scheitern, ist die Kompliziertheit und Langwierigkeit der Verfahren, die zu absolvieren sind, bis man endlich seinen Behindertenausweis besitzt oder die Finanzierung von Leistungen durch die Krankenkasse gesichert ist. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der Erwerb "Lebenspraktischer Fertigkeiten" von den Krankenkassen nicht finanziert wird - ein Problem, auf das unter anderem Dr. Herbert Demmel immer wieder hinweist. Die für viele Leistungen erforderlichen langen und mühsamen Antragsverfahren werden oft nicht durchgestanden oder gar nicht erst angegangen. Auch hier kommt den Ärzten eine zentrale Rolle zu, denn was sie nicht verschreiben, wird von der Kasse nicht bezahlt. Und was sie nicht für nötig halten, verschreiben sie nicht... Nicht selten waren die Gesprächspartner von Arzt zu Arzt gelaufen, bis sich jemand fand, der bereit war, ihnen doch noch ein Lesegerät zu verordnen...
4. Mangelnde Mobilität
Ein letzter Punkt sei noch kurz angesprochen: Mobilitätseinschränkungen, die oft aus einem Zusammenwirken der Sehschädigung mit anderen Behinderungen resultieren, können es unmöglich machen, Termine außerhalb der eigenen Wohnung ohne fremde Hilfe wahrzunehmen. Solche Angebote sind deshalb für viele Menschen die erst im Alter ihren Sehverlust erlitten haben ungeeignet.
Lösungsgedanken in Stichworten als Diskussionsanregungen:
- Ärzte als Ausgangspunkt für Informationen nutzen; nicht als Beratungsinstanz (unrealistisch), sondern als Kontaktpunkt: eine feste, den Patienten bekannte Kontaktadresse, von der aus es weitergeht.
- Case-Management: notwendig ist eine feste Ansprechperson, die mit ausreichenden Kompetenzen ausgestattet ist, um durch den Fall zu führen: neben blinden- und sehbehindertenspezifischen Qualifikationen auch psychologische Kompetenzen! Außerdem: Unterstützung bei Antragstellungen; Beratung über und Vermittlung von anderen Unterstützungsleistungen.
- ambulantes Angebot: für alle zugänglich, außerdem Möglichkeit, Bedürfnisse und Probleme im eigenen Lebensraum anzugehen, wo sie auftreten.
- sehr stark auf das Individuum zugeschnittene Angebote, die nicht nur auf den Bereich Anpassung an Sehbehinderung reduziert sind, sondern darüber hinausgehen können: Freizeitbedürfnisse, soziale Bedürfnisse... Individuelle Lösungen gemeinsam finden! Hilfe zur Selbsthilfe anregen, Erfolgserlebnisse beim "in die Hand nehmen" der eigenen Situation ermöglichen!
- neuere Erkenntnisse über "Hochaltrigkeit" müssen überdacht und eventuell in bestehende Konzepte eingebracht werden.