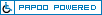Inhalt Mitte
Hauptinhalt
.Blinde und sehbehinderte ältere Menschen als besondere Zielgruppe unserer Arbeit - 6.1
6.1
Christine Sowinski
Hausgemeinschaften für sehbehinderte und blinde Menschen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Dr. Schulze, ich bedanke mich für die Einladung. Es ist ja das erste Mal, dass ich bei solch einem Treffen dabei bin.
Kuratorium Deutsche Altershilfe
Ich wollte vorab etwas zum Kuratorium Deutsche Altershilfe sagen. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe, abgekürzt KDA, ist eine Stiftung, die seit nunmehr 40 Jahren existiert. Das Ehepaar Wilhelmine und Heinrich Lübke, der ehemalige Bundespräsident, haben das KDA gegründet mit dem Ziel, auf die Situation älterer Menschen aufmerksam zu machen. Die Stiftung soll neue Wege in der Altenhilfe aufzeigen. Diesem Leitbild fühlen wir uns verpflichtet, das Thema heute ist u. a. neue Wohnformen. Inzwischen ist es so, dass das Thema Hausgemeinschaften im KDA so einen hohen Stellenwert bekommen hat, dass wir überwiegend bei Neubauten im Sinne von Hausgemeinschaften beraten.
Meine Aufgabe im KDA ist das Thema Pflege, ich bin Krankenschwester und Diplom-Psychologin. Ich bin seit 28 Jahren im Bereich der Pflege tätig und habe lange in der stationären Altenpflege gearbeitet. Im KDA machen wir u. a. Politikberatung. Wir werden häufig angefragt, aber ob wir immer gehört werden, das ist eine andere Sache. Wenn Sie sich intensiver über das KDA und seine Aufgaben informieren möchten, können Sie dies über unsere Homepage unter www.kda.de tun.
Zusammenarbeit mit Herrn Schäfer
Herrn Schäfer kenne ich seit 1996. Wir haben uns bei einem sehr erfreulichen Anlass kennengelernt. Damals hatte das KDA über die Europäische Union ein Projekt bekommen in dem es darum ging, sich mit mehreren Experten aus verschiedenen Ländern über Seh- und Hörbeeinträchtigung älterer Menschen auszutauschen. Herr Schäfer war auch da und hat uns im KDA nachhaltig beeindruckt. Er hat ebenso wie Herr Dr. Schulze eine Veröffentlichung beim KDA zum Thema Sehbeeinträchtigung herausgebracht. Wir haben nach dieser Veranstaltung Herrn Schäfer sehr oft weiterempfohlen. Herr Schäfer und ich hatten dann nochmals intensiveren Kontakt als wir uns für die Entwicklung eines nationalen Pflegestandards zum Thema Sehbeeinträchtigung eingesetzt haben, was bisher leider noch nicht zustande kam.
Nationale Expertenstandards in der Pflege
In der Pflege haben wir oft das Problem, dass wir nur auf Erfahrungswerte zurückgreifen und nicht auf wissenschaftlich fundiertes Wissen. Das war eine große Kraftanstrengung in Deutschland, sich national auf bestimmte Umgangsweisen zu einem Thema zu einigen.
Ich habe selber gedacht, das erlebe ich nicht mehr, dass wir in Deutschland bei bestimmten Pflegethemen nach einheitlichen Vorgaben arbeiten. Dank Frau Prof. Dr. Schiemann von der Fachhochschule Osnabrück, die das sozusagen zu ihrem Lebenswerk gemacht hat, hat sich die deutsche Pflegeszene wirklich darauf verpflichtet, nach diesen Standards zu arbeiten. Ob das in der Praxis immer so ist, ist eine andere Frage.
Seit dem Jahr 2000 gibt es einen nationalen, wissenschaftlich gestützten Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe in der Pflege. Dieser Standard ist sozusagen rechtsverbindlich, wenn er in einer Konsensuskonferenz verabschiedet und danach veröffentlicht worden ist. Nach Aussagen des Juristen Hans Böhme (2000) ist ein Expertenstandard eine Art vorweggenommenes Sachverständigen-Gutachten.
Wenn also ein Dekubitus eingetreten ist und die betreffende Person klagen würde, dann wird erst geprüft, ob die Pflegemitarbeiter sich an die Vorgaben des Nationalen Expertenstandards gehalten haben. Wir haben zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Vortrages drei gültige Standards (Dekubitusprophylaxe [2000], Entlassungsmanagement [2002], Schmerzmanagement [2004]).
Im Jahre 2004 wird vom KDA in Zusammenarbeit mit anderen ein Expertenstandard zum Thema Sturzprophylaxe in der Pflege erarbeitet.
Hausgemeinschaften
Warum hat sich das KDA dem Thema Hausgemeinschaften zugewandt? Anfang der 90er Jahre war es so, dass empfohlen wurde, dass, wenn Menschen nicht mehr zuhause leben können, und sie müssen oder wollen in ein Altenheim einziehen, es dann am günstigsten wäre, wenn 30 Menschen auf einer Einheit leben. Dies nannte man früher Station, moderner heißt es jetzt Wohnbereich, da es sich nicht um ein Krankenhaus handelt, sondern ums Wohnen geht.
Die demographische Entwicklung hat diese Art der Konzeption überholt, denn der Anteil der Menschen, die mit einer Demenz in ein Heim einziehen, ist immens angestiegen. Inzwischen sind ca. 50 bis 70 % aller Menschen, die in einer stationären Altenhilfeeinrichtung leben, dement. Menschen mit einer Demenz haben nicht das Bedürfnis mit 30 Menschen zusammen zu leben, weil das völlig verwirrend und beängstigend für sie ist. Demenziell erkrankte Menschen müssen vor Reizüberflutung geschützt werden.
Das war natürlich tragisch, weil es viele Einrichtungen gab und gibt, die, auch beraten durch das KDA, bis Anfang der 90er Jahre diese sog. 3. Generation des Altenheimbaus vollzogen haben. Diese 3. Generation war eine Art von Wohnhäuser, in denen auch gepflegt werden konnte. Aus meiner pflegerischen Erfahrung war es so, dass Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen nicht gerne ganz "eng" mit vielen anderen älteren Menschen leben wollten und deshalb diese damals konzipierten größeren Wohneinheiten mit 30 Bewohnern auf einer Ebene gar nicht so schlecht fanden. Außerdem sprachen wirtschaftliche Gründe für diese Art der Konzeption und Organisation.
Dann kam die Pflegeversicherung und es zeigte sich, dass viele Menschen nun zu Hause gepflegt werden könnten und bis zum Tod nie in ein Altenheim wollten.
KDA-Erfahrungen zeigen aber, dass es schwierig sein kann, Menschen mit Demenz mit Hilfe der häuslichen Pflege zu begleiten. Schwierig wird es immer dann, wenn demenziell Erkrankte nachts das Haus verlassen wollen oder sich selber gefährden. Angehörige sind, insbesondere durch die gestörte Nachtruhe, innerhalb von ein paar Monaten psychisch und physisch so beeinträchtigt, dass die Familie sich notgedrungen für eine Unterbringung im Heim entscheidet.
Hausgemeinschaften werden als kleine Wohngruppen mit ca. 8 bis 10 Bewohnern definiert, die in einer Wohneinheit zusammenleben. Bei den Hausgemeinschaften ist das Leitbild Normalität, Vertrautheit und Geborgenheit. Der Mensch mit all seinen Bedürfnissen soll im Mittelpunkt stehen. Die wohnliche und überschaubare Architektur und der weitgehendste Abbau zentraler Versorgungssysteme kennzeichnet eine Hausgemeinschaft. Idealerweise sollte jeder Bewohner ein Einzelzimmer haben. Sämtliche Flächen, die man im Heim braucht, wie eine Großküche, Großwäscherei usw., braucht man in Hausgemeinschaften nicht; man macht das alles innerhalb dieser Wohnung/Hausgemeinschaft. Das Problem ist in Hausgemeinschaften immer der Nachtdienst, weil auch die verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen im Heim sagen - denn Hausgemeinschaften sind die 4. Generation der Heime - man muss innerhalb von 24 Stunden jederzeit eine Pflegefachkraft zur Verfügung haben, die das ganze Geschehen in den Hausgemeinschaften fachlich begleitet. Das ist natürlich ganz schwierig, wenn Sie nur eine einzelne Achtereinheit als Hausgemeinschaft haben; Sie müssen dann Verbundlösungen finden.
Inspiration aus Frankreich und den Niederlanden
Eine Diskussion über Hausgemeinschaften als neue Wohnform für ältere Menschen kam Anfang der 90er Jahre auf. Deutschland wurde insbesondere stark von Hausgemeinschaften in Frankreich und den Niederlanden inspiriert. Die Franzosen haben sog. "Cantous", das bedeutet "rund um den Herd versammelt", entwickelt. Darin zeigt sich auch das Grundprinzip der Hausgemeinschaft, in der 8 bis 10 oder 12 Zimmer um eine Wohnküche angeordnet sind. Das Faszinierende ist, dass, weil auf eine Großküche verzichtet wird, in den Küchen in Sichtkontakt der Bewohner gekocht wird. Das ist insofern sehr genial, weil das Personal, das man im Heim zum Kochen und für die Wäscherei bräuchte, in Anwesenheit der Menschen mit Demenz da ist. Also man erhöht die Effizienz, denn das Problem ist ja, dass Menschen mit Demenz permanent jemanden brauchen, an dem sie sich orientieren. Die Effekte von diesen Hausgemeinschaften, auch aus pflegerischer Sicht, liegen in der Qualität weit über denen eines traditionellen Heims.
Bezugs(personen)pflege
Gerade wenn traditionelle Heimeinrichtungen umorganisieren, gibt es auch die Möglichkeit, Bezugspflege - also pro Schicht bekommt jeder Bewohner eine Bezugsperson, egal welche Qualifikation sie hat - einzuführen. Dabei muss die Fachkraft, die in der Nähe arbeitet, die sog. Supervision leisten. Der Vorteil ist, man kann die personellen Ressourcen besser ausschöpfen.
Psychologische Probleme in traditionellen Einrichtungen
In traditionellen Einrichtungen gibt es Probleme psychologischer Art. In dem Moment, wo Mitarbeiter eine gewisse Anzahl von Menschen zu begleiten haben, gibt es einen psychischen Abwehrmechanismus, der eine Art Ökonomieeffekt hat. Diesen kann man bei der Funktionspflege sehr deutlich beobachten. Um Nähe nicht an sich herankommen zu lassen, fangen Menschen an, teilweise ohne, dass es ihnen bewusst ist, die Pflege stärker funktional zu organisieren, was wiederum für die betroffenen älteren Menschen kontraproduktiv ist. Man fängt unbewusst an, nicht den Menschen, weil das ja auch bedrohlich ist, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Tätigkeit.
Dies ist aber auch wiederum für die Mitarbeiter frustrierend, weil sie ja nicht für eine funktionelle Pflege angetreten sind. Wir sagen, man muss gegen diese immerwährende Gefahr, die Tätigkeiten, also z. B. Bettenmachen, Tabletten verteilen, zu stark in den Mittelpunkt zu stellen, angehen. Diese vom KDA empfohlene Organisationsform (Bezugspflege) heißt, dass man "Menschen zu Menschen" bringt. Durch diese engere Verzahnung von Mitarbeitern zu älteren Menschen bekommen die Pflegenden Angst, von den Problemen der Bewohner psychisch "aufgefressen" zu werden. Langfristig ist die Bezugspflege aber - so sagen die betroffenen Mitarbeiter - die befriedigendere Arbeitsform.
Der große Nachteil dieser 30er Einheiten, die wir auch im KDA noch Anfang der 90er Jahre empfohlen haben, ist, dass sich z. B. drei Mitarbeiter, die für 30 Bewohner zuständig sind, als "wir als Team für 30 Bewohner" erleben. Dann sagen die Mitarbeiter oft "man kann doch 30 Menschen gar nicht so im Blick haben".
Es wäre schon ein Riesenvorteil, diese 30er Gruppe auf drei Zehner-Gruppen, zumindest für diese eine Schicht, aufzuteilen. Also jeder Mitarbeiter kümmert sich "nur" um 10 Bewohner. Das ist immer noch eine große Anzahl, aber es ist besser als drei für 30.
TEAM - Toll ein anderer macht’s
Was sich in der Pflege sehr negativ niederschlägt, ist der "TEAM-Gedanke". Und das Wort T E A M haben wir definiert als "Toll Ein Anderer Macht’s".
Hierzu gibt es auch eine Untersuchung von Frau Prof. Dr. Renate Tewes (2002), die den Studiengang Pflegewissenschaften/Pflegemanagement an der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden leitet, in der sie herausgefunden hat, dass Pflegende auch im Krankenhaus Angst vor dieser Verantwortung haben. In der Pflege hat man ja Verantwortung über Leben und Tod. Wenn ich also einen gravierenden Pflegefehler begehe, kann das den Tod eines Menschen nach sich ziehen.
Um aus dieser Angst herauszukommen, versucht man die Verantwortung nicht zu nah an sich herankommen zu lassen. Man pflegt lieber im TEAM und versucht das so zu bewältigen. Unsere Erfahrung im KDA ist, dass wenn ein Team eine Gruppe pflegt, die Fehlerquote höher ist. Es ist also besser, der Einzelne trägt die Verantwortung und das ganze wird durch das Management begleitet und supervidiert.
Ständiger Sichtkontakt in Hausgemeinschaften
Dass natürlich Hausgemeinschaften, wo man ständig Sichtkontakt zu den Bewohnern hat, viel bessere Ergebnisse bringen, insbesondere im Hinblick auf Menschen mit Demenz, liegt auf der Hand. Menschen mit Demenz haben ein großes Problem mit der Mangelernährung. In Hausgemeinschaften wird das minimiert dadurch, dass ständig Essen angeboten wird. In Heimen ist eines der gravierendsten Probleme, dass die Menschen dort zu wenig trinken und schlecht ernährt sind. In Hausgemeinschaften sagen die Mitarbeiter z. B., sie müssten eher ein bisschen aufpassen, dass die Bewohner nicht zu stark zunehmen, da ständig Essen zur Verfügung steht. Dieses Zunehmen ist aber nicht so gefährlich wie die Gefahr, dass Menschen immer weiter abnehmen und dehydriert (ausgetrocknet) sind.
Es stellt sich natürlich auch immer die Frage, ob andere Gruppen, z. B. sehbehinderte und blinde Menschen, wegen der Kleinräumigkeit einer Hausgemeinschaft, dort besser leben können. Aber auch in traditionellen Einrichtungen kann man durch Reorganisation der bestehenden Einrichtungen hin zu kleineren Einheiten kommen, um es auch für sehgeschädigte Menschen lebenswerter zu machen. Ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Schäfer und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Literatur
Böhme, Hans (2000): Standards sind vorweggenommene Sachverständigengutachten. Rechtsexperte Böhme zur Verbindlichkeit der Anti-Dekubitus-Leitlinien. In: PRO ALTER Heft 3, S. 55-56. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.), Köln (Sie finden diesen Artikel auf unserer Homepage unter www.kda.de )
Maciejewski, Britta; Sowinski, Christine; Besselmann, Klaus; Rückert, Willi (2001): Qualitätshandbuch - Leben mit Demenz. Zugänge finden und erhalten in der Pflege, Förderung und Begleitung von Menschen mit Demenz und psychischen Veränderungen. Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln
Maciejewski, Britta; Sowinski, Christine (2000): Hausgemeinschaften aus pflegerischer Sicht. In: Herausforderung Demenz: Betreuungsmodelle für die Zukunft. Dementenbetreuung in der stationären Pflege. Dokumentation einer Veranstaltung des Kreisausschusses des Main-Kinzig-Kreises am 12. April 2000 in Schlüchtern, S. 26-45.
Maciejewski, Britta; Sowinski, Christine (2001): Hausgemeinschaften aus pflegerischer Sicht. In: Qualitative Anforderungen an den Pflegeheimbau unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen - Teil 6: Hausgemeinschaften. Dokumentation über ein Expertengespräch am 25./26. März 1999 in Braunschweig. KDA-Schriftenreihe Thema 141, Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.) Köln, S. 34-47
Maciejewski, Britta; Sowinski, Christine (2000): Das "KDA-Türöffnungskonzept".
In: Demenz und Pflege. Mabuse-Verlag, Frankfurt/Main, 2000, S. 268-289
Schäfer, Karl Matthias (1997): Erblindung im Alter. KDA-Schriftenreihe Vorgestellt 62. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.), Köln
Schulze, Hans-Eugen (2003): Sehbehinderten und blinden alten Menschen professionell begegnen und helfen. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.), Köln
Schulze, Hans-Eugen (1999): Nicht verzagen, sondern wagen - Praktische Hilfen für Altersblinde und ihre Angehörigen. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.), Köln
Sowinski, Christine; Gennrich, Rolf; Schmitz, Thomas; Schwantes, Harro; Warlies, Christine (1999): Organisation und Stellenbeschreibungen in der Altenpflege. Planungshilfen für ambulante Dienste, Hausgemeinschaften, teilstationäre und stationäre Einrichtungen. Teil I: Fachkraftquote, vorbehaltene und Supervisions-Aufgaben von Pflegefachkräften, Aufgaben von Pflegehilfskräften. KDA-Schriftenreihe Forum 36. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.), Köln (hier findet man viele Aussagen zur Bezugspersonenpflege)
Tewes, Renate (2002): Pflegerische Verantwortung. Eine empirische Studie über pflegerische Verantwortung und ihre Zusammenhänge zur Pflegekultur und zum beruflichen Selbstkonzept. Huber, Bern
Internet: www.kda.de
Wenn Sie regelmäßig über Neuerscheinungen und KDA-Veranstaltungen informiert werden möchten, können Sie gerne unseren Online-Newsletter kostenlos abonnieren, den Sie jederzeit wieder abbestellen können ( www.kda.de > Interaktiv > Newsletter).
Beratungen zum Thema Hausgemeinschaften bietet die Abteilung Architektur an (Assistenz Frau Riemer, Tel: 0221/931847-24).
Informationen und Bestelladresse zu den Expertenstandards in der Pflege: Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hrsg.) (April 2004): Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege, Entwicklung - Konsentierung - Implementierung. ISBN: 3-00-010559-X, 148 Seiten, Preis: 17,50 € (inkl. Versand)
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hrsg.) (Februar 2004): Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege. Entwicklung - Konsentierung - Implementierung. 2. Auflage mit aktualisierter Literaturstudie (1999-2002). ISBN: 3-00-009033-9, 137 Seiten, Preis: 17,- € (inkl. Versand)
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hrsg.) (Januar 2004): Sonderdruck Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege, einschl. Kommentierung und Literaturanalyse. ISBN: 3-00-012743-7, 116 Seiten, Preis: 15,- € (inkl. Versand)
Die o. g. Expertenstandards können schriftlich bestellt werden beim: Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)
Fachhochschule Osnabrück
Fachbereich Wirtschaft
Postfach 19 40
49009 Osnabrück
Fax: 0541 / 969-2971
E-Mail: j.schemann@fh-osnabrueck.de
Christine Sowinski
Referat Pflegeorganisation
Kuratorium Deutsche Altershilfe
An der Pauluskirche 3
50677 Köln
Tel: 0221 / 931847-36 (Assistenz Petra Germund)
Fax: 0221 /9 31847-6
E-Mail: christine.sowinski@kda.de